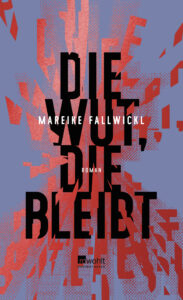Der Verein sagbar ist am Linzer Barbarafriedhof an der Schnittstelle von Kultur- und Trauerarbeit tätig. Lisa-Viktoria Niederberger im Gespräch mit nicole honeck, die den Verein im Frühjahr 2021 mitbegründet hat.
Lisa-Viktoria Niederberger: Wie bist du auf die Idee gekommen, dich kulturarbeiterisch mit dem Thema Trauer zu beschäftigen?
nicole honeck: Ich hatte nie Berührungsängste mit dem Tod und habe mich damit auch schon öfter persönlich auseinandersetzen müssen. Meine Partnerin Verena hat als Bestatterin gearbeitet und ich im Kulturbereich, und wir hatten die Idee, das zu kombinieren. Kunst und Kultur ermöglichen neue Zugänge zu einem Thema und wir haben erlebt, dass Menschen im akuten Trauerfall handlungsfähiger bleiben, wenn sie sich davor schon einmal mit dem Tod auseinandergesetzt haben. Das nimmt nicht die Schwere des Verlusts, aber man weiß eher, was man will, und kann das leichter einfordern. Genau da setzen wir als Verein an.
Was macht ihr konkret?
Jedes Jahr wird in Österreich am 8. August der Memento-Tag gefeiert: ein Anlass, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. 2021 hatten wir da ein großes Programm: Streetart an der Friedhofsmauer, eine Performance, ein Spiel, das dazu einlädt, über den Tod zu sprechen. Ganze Familien haben mitgemacht und uns rückgemeldet, dass das gegen die Trauer hilft. Wir bieten Trauerberatung und Workshops an, z.B. zum Thema ‘Trauerreden schreiben’. Verena hat eine Ausbildung zur Clownin, das binden wir ein. Und wir haben eine Sargbar. Das ist ein umgebauter Natursarg, den man wie eine Bar verwenden kann. Da kommen Getränke rein und schon ergeben sich leichter Gespräche. Natürlich erleben wir auch immer Berührungsängste bei dem Thema, aber das hängt, denke ich, viel mit der eigenen Angst vor der Endlichkeit zusammen. Damit tun sich viele schwer.
Wenn man sich, wie du, tagtäglich mit dem Tod auseinandersetzt – wird es da leichter?
Trauer ist ein Gefühl, das anerkannt werden muss. Das man rauslassen muss. Klar schlägt uns oft zuerst eine Schwere entgegen, die spürt man bei vielen trauernden Menschen. Manchmal reicht es, einfach nur zuzuhören. Man schafft so einen Raum von Mitgefühl, in dem sich Leute ernst genommen und gehört fühlen. Nach solchen Gesprächen erlebe ich oft, dass Trauernde trotzdem wieder lachen und Spaß haben können, dass alles wieder etwas leichter ist. Für mich und das Gegenüber. Humor hilft ganz toll auch bei der Resilienz.
Ist es das, was ihr „Death Positivity“ nennt?
Bei der „Death Positivity“ geht es darum, das Thema Tod ins Leben zu holen und zum Beispiel darüber zu reden, wie man selbst gerne sterben möchte und welche Wünsche man hat, wenn man geht. Dass die Trauerfeier den eigenen Wünschen entspricht, erleichtert den Abschied. Wir erleben außerdem oft, wie viel Wissen verloren gegangen ist, etwa dass man Verstorbene auch zuhause aufbahren könnte, wenn man dort eine Trauerfeier veranstalten möchte. Ich würde mir generell Veränderungen der Trauer- bzw. Friedhofskultur wünschen.
Wie könnten solche Veränderungen aussehen?
Zuerst sind Information und Rücksichtnahme auf die individuellen Wünsche der Trauernden zentral. Welche Bestattungsformen gibt es? Darf ich die Asche mit nach Hause nehmen und dort aufbewahren? Kann ich am Friedhof ein Abschiedsfest machen? Ich wünsche mir auch eine neue Friedhofskultur. Friedhöfe sind grüne Oasen in den Städten, diese Orte sollte man individueller nutzen können. Warum sollen Eltern mit ihren Kindern kein Picknick am Grab der Oma machen?
Außerdem wäre es schön, wenn es permakulturelle Friedhöfe gäbe, auf denen man auch Nutzpflanzen setzen kann. Es gibt auch schon Möglichkeiten, die Körper der Verstorbenen entsprechend zu verwenden. Das nennt sich ‘Reerdigung’ und wird in Deutschland bereits angeboten. Dabei wird der Körper mit Erde und bestimmten Mikroorganismen in einen Kokon gegeben, nach 40 Tagen entsteht aus ihm humusreiche Erde, die auf dem Friedhof für Pflanzungen verwendet werden kann. Das ist ein spannendes, nachhaltiges Konzept, das in Österreich aber derzeit leider noch nicht möglich ist, weil hier noch an der Sargpflicht festgehalten wird. Es gibt leider auch keine Trauerkarenz oder Trauertage, die man wie Krankenstandstage einfach in Anspruch nehmen kann. Da braucht es also gesetzliche und strukturelle Änderungen.
Ist es schwer, Regeln aufzustellen, weil Trauer so individuell ist?
Ich denke schon. Auch die Dauer und Intensität von Trauer sind sehr individuelle Prozesse. Es hängt immer von der Beziehung ab, die man zu den Verstorbenen hatte. Die Todesumstände spielen eine Rolle: Stirbt jemand altersbedingt und kann ich mich verabschieden, ist das sicherlich leichter für die Hinterbliebenen zu verarbeiten, als ein schwerer Unfall oder ein Suizid. Wie lange Trauer dauern darf, ist schwer festzulegen. Manchmal kommen Menschen zu uns, die sehr lange mit einem anderen Menschen zusammen gewesen sind, ihn verloren haben und erzählen, dass die Kinder sagen: „Hol‘ dir jemanden, versuch dich irgendwie abzulenken oder das zu verarbeiten.“ Wir fragen dann immer, wie lange sie schon verwitwet sind. Wenn sie antworten „Zwei Jahre“, klingt das natürlich erst einmal lange, aber diese Menschen waren ja oft über fünfzig Jahre zusammen. Wo ist die Relation, warum sollte ich nur zwei Jahre um einen Menschen trauern dürfen, der mich fast das ganze Leben begleitet hat?
Hast du Ratschläge für Trauernde oder jene, die sie unterstützen möchten?
Dass man sich Zeit nimmt, auf sich selbst zu hören und sich überlegt, was man eigentlich braucht. Für Freund*innen von Trauernden ist es am Wichtigsten, zu zeigen, dass man da ist. Empathie ist ein wichtiges Stichwort. Es geht ums Zuhören und darum, dass man die Trauer der Anderen zulässt und aushält.
—