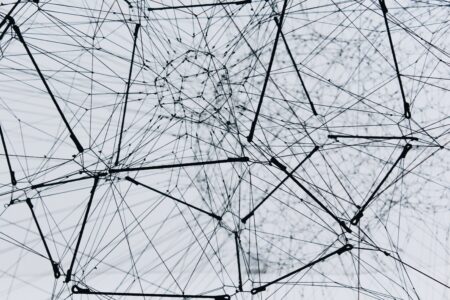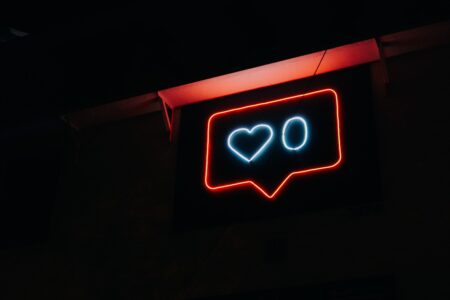Geschlechtliche Identitäten sind auch in Krisenzeiten stark von der Wirkungsmacht von Sprache betroffen, argumentiert Susanne Hochreiter.
Viel ist dieser Tage von Sprache die Rede. Die Pandemie hat uns nicht nur zahlreiche neue Wörter wie ‚Corona-Party‘ oder ‚Maskenpflicht‘ gebracht, auch bekannte Begriffe wie ‚hamstern‘ sind aktualisiert worden. Metaphern wie das geplante ‚Hochfahren‘ einer Gesellschaft oder die Rhetorik des Innenministers, der von ‚Lebensgefährdern‘ spricht, werden diskutiert. Worte haben Wirkung – das wird gerade jetzt sehr deutlich. Politische Rede, mediale Kommunikation, das private Gespräch: Immer spielt es eine große Rolle, welche Worte wie gewählt werden.
Ein interessantes Beispiel ist das Wort ‚Systemerhalter‘. Gemeint sind jene Menschen, die trotz der Ausgangsbeschränkungen ihrer Arbeit nachgehen mussten, weil ohne sie unsere Grundversorgung zusammengebrochen wäre: Gesundheitswesen, öffentlicher Verkehr, Lebensmittelhandel und Ähnliches. Wer aber sind diese Menschen? Wen genau stellen wir uns vor? Was sagt uns ein Wort wie ‚Systemerhalter‘ darüber? Welche Berufe oder Tätigkeiten werden überhaupt als systemrelevant verstanden? Kunst und Kultur sind – wie wir erfahren haben – nicht ‚mitgemeint‘.
Wir könnten vermuten, dass ‚Systemerhalter‘ sehr wichtige Personen sind, mit hohem Ansehen und entsprechender Entlohnung. Es sind jedoch mehrheitlich schlechter bezahlte Jobs mit geringer Reputation, die sich als systemerhaltend erwiesen haben. Es zeigte sich auch, dass darunter der Anteil von Menschen, die einen sogenannten ‚Migrationshintergrund‘ haben, hoch ist. Zudem haben wir gelernt, dass es mehrheitlich Frauen sind, die im Handel, in Pflegeberufen, als Reinigungskräfte arbeiten. Nicht zu reden davon, dass diese meist zugleich familiäre ‚Systemerhalter‘ sind. Sollte es also nicht ‚Systemerhalterinnen‘ heißen?
Die Systemerhalterinnen
Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben sich in den letzten 40 Jahren mit der Frage befasst, inwiefern das Geschlecht eines Menschen sprachlich relevant ist: Welche Rolle spielt es, wenn zur Bezeichnung von Personengruppen ein generisches Maskulinum verwendet wird? Wenn also allgemein von Politikern, Ärzten oder Lehrern die Rede ist, obwohl es – übrigens eine historisch junge Errungenschaft – auch viele Frauen in diesen Berufen gibt? Die Forschungsergebnisse zeigen deutlich: Es macht einen Unterschied, ob Menschen in unserem Sprechen und daher in unserem Denken vorkommen.
Die Arbeiter sind Frauen
Ein Beispiel: „Die Sozialarbeiter gingen durch den Bahnhof. Weil das Wetter so schön war, trugen einige der Frauen keinen Mantel.“ Diese beiden Sätze stammen aus einer Studie der Forschungsgruppe Gender Representation in Language. Drei Experimente, in drei verschiedenen Sprachen durchgeführt (Englisch, Französisch, Deutsch), weisen nach, dass die männliche Form im Plural keineswegs alle Personen (mit-)meint. In der mentalen Repräsentation von Geschlecht sind die Sozialarbeiter für die meisten Rezipient*innen des Satzes Männer – andernfalls wären wir nicht überrascht vom Folgesatz, in dem Frauen vorkommen.
Hans wird Astronautin
Sprache ist nicht nur eine Frage der Anerkennung und der Sichtbarmachung, sondern auch eine von Lebensentwürfen. Yes, I can ist der Titel einer Studie von Dries Vervecken und Bettina Hannover aus dem Jahr 2015. Hier wurden Schulkindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren verschiedene Berufsbezeichnungen angeboten: stereotyp männliche Berufe wie Astronaut oder Lastwagenfahrer und stereotyp weibliche wie Kosmetikerin oder Sekretärin. Jeder Beruf wurde den Kindern vorgelesen und kurz erklärt: für eine Gruppe in Paarformen, also Astronaut/Astronautin, für die zweite Gruppe nur in der männlichen Form. Die Ergebnisse müssen uns aufrütteln: Kinder jeglichen Geschlechts trauen sich einen Beruf eher zu, wenn er in der Paarformel präsentiert wird.
Sprachlich vorkommen
Sprache kann ermöglichen, Sprache kann auch verletzen. Im Deutschen versuchen Modelle wie der Gender-Stern, einen Ausweg aus einem sprachlichen Missstand zu bieten, der Konsequenzen hat: für Frauen, für queere und transgeschlechtliche Menschen, für Kinder und letztlich für uns alle. Wie wir miteinander leben, welche Gesellschaft wir entwickeln, wer gleichberechtigt teilhaben kann, welches Leben überhaupt vorstellbar ist: All das hängt davon ab, dass alle in angemessener und wertschätzender Weise sprachlich vorkommen.
Dieser Text erschien in leicht veränderter Form am 12. 5. 2020 auf derstandard.at.
Susanne Hochreiter ist Literaturwissenschaftlerin, Theaterpädagogin und Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der Universität Wien. Ihre Forschungsinteressen fokussieren auf neuere deutschsprachige Literatur, Gender und Queer Studies sowie Comics.
Zum Gendern:
Ich verwende aktuell den Genderstern in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Universität Wien.