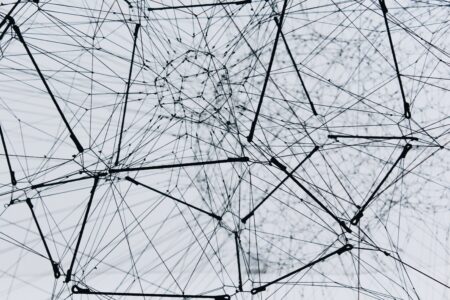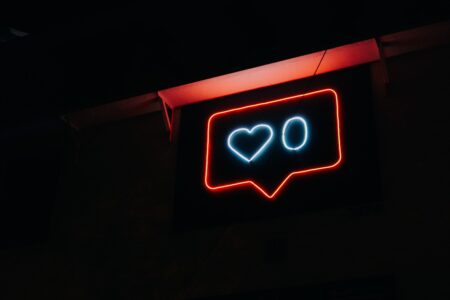„Wer Kultur sagt, sagt auch Verwaltung, ob er will oder nicht.“
Theodor W. Adorno
Wenn Kunst- und Kulturarbeiter*innen, etwa im Zuge von Förderanträgen oder Genehmigungsansuchen, auf Beamt*innen treffen, scheinen Spannungen und Konflikte vorprogrammiert. Warum das so ist und was dagegen hilft? Florian Walter stellt fünf Maßnahmen zum Verhältnis von Kultur und Verwaltung zur Debatte.
Während sich die Bürokratie durch Präzision und Planbarkeit auszeichnet, steht die Kunst- und Kulturarbeit (KKA) für Innovation, Kreativität und Spontaneität. Für den Philosophen und Soziologen Theodor Adorno ergibt sich dadurch eine unauflösliche Ambivalenz: Während Verwaltung der Kultur zwangsweise schade, da sie diese einer Kosten-Nutzen-Abwägung unterwirft, drohe der Kultur ohne die Verwaltung der Verlust ihrer gesamten Existenz, da sie so ihre staatliche Legitimation und damit finanzielle Grundlage verliere. Wie kann diesem Spannungsverhältnis begegnet, wie kann es gelockert oder sogar gelöst werden?
1) Bürger*innennähe beweisen: Kulturverwaltung auf die lokale Ebene verlagern
KKA wird in Österreich von der öffentlichen Hand finanziell gefördert. Die Abwicklung macht einen großen Teil der Verwaltungstätigkeit aus. Mit dem Kunstförderungsgesetz des Bundes und den Kulturförderungsgesetzen der Länder existieren rechtliche Grundlagen jedoch nur auf den oberen Verwaltungsebenen. Wenn Kommunen künstlerische und kulturelle Aktivitäten finanziell unterstützen, erfolgt dies im Ermessen der Städte und Gemeinden. Dass Kulturverwaltung damit weit entfernt von den Antragsteller*innen stattfindet, ist schade, da es gerade dann eher zu einem Spannungsverhältnis kommt, wenn Verwaltung nicht greifbar ist. Eine Verlagerung der Bürokratie auf die regionale/lokale Ebene wäre eine Möglichkeit, hier Abhilfe zu schaffen. Selbstverständlich kann dies nicht im Rahmen der bestehenden finanziellen Möglichkeiten der Kommunen geschehen. Vielmehr müsste überlegt werden, ob Bezirkshauptmannschaften, Gemeindeämter oder Magistrate hier Aufgaben der Bundes- und Landesverwaltung übernehmen können oder ihnen die entsprechenden Mittel aus Steuereinnahmen des Bundes zur Verfügung gestellt werden.
2) Kompetenzen klären: Wer trifft inhaltliche Entscheidungen?
Konflikt entsteht vor allem dann, wenn in der Wahrnehmung der Kunst- und Kulturarbeiter*innen Förderungen oder Aktivitäten durch die Verwaltung verunmöglicht werden, also die wahrgenommene ‚Macht der Beamt*innen‘ wirkt. Diese ist durch das Legalitätsprinzip – Verwaltung darf nur auf Basis von Gesetzen stattfinden – zwar theoretisch beschränkt, existiert aber in der Praxis sehr wohl. So können Ansuchen etwa mit subjektiver Einschätzung (positiv wie negativ) an die politischen Entscheidungsträger*innen weitergeleitet werden oder einfach kommentarlos. Existiert die Wahrnehmung, dass Beamt*innen ihre Macht zuungunsten der Förderwerber*innen einsetzen, wird oft der Weg über die Politik gesucht, die dann Druck auf die Verwaltung ausübt. Dies entlastet das Spannungsverhältnis nicht. Es wäre also angeraten, das Legalitätsprinzip auch in der Praxis stärker wirken zu lassen. Formale Aspekte sollen von Beamt*innen geklärt werden, allen inhaltlichen Fragen müssen sich Politiker*innen stellen. Schließlich können diese abgewählt werden, wenn ihre Entscheidungen nicht goutiert werden.
3) Zugang erleichtern: Diversifizierung des Verwaltungspersonals
Die öffentliche Verwaltung ist in Österreich stark von Jurist*innen dominiert. Auch in den Kulturverwaltungen finden sich in Führungspositionen überwiegend Absolvent*innen eines rechtswissenschaftlichen Studiums. Das Gendersternchen ist hier nur begrenzt der inhaltlichen Korrektheit geschuldet. Gerade in leitenden Positionen dominieren (wie in allen anderen Bereichen des Berufslebens) weiße Männer über 50. Diese fehlende Diversität schlägt sich auf das Verhältnis zwischen Beamt*innen und Kulturarbeiter*innen doppelt nieder: Sie befördert den aus der Sozialpsychologie schon in den 1970er Jahren beschriebenen ‚in-group bias‘, also die Bevorzugung jener Menschen, die als zur ‚eigenen‘ Gruppe gehörig gedacht werden. Das Jurist*innenmonopol begünstigt außerdem eine starke Fokussierung auf formale und prozedurale Korrektheit. Dadurch werden – so die Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky – genau jene sozialen, ökonomischen und geschlechtsspezifischen Verhältnisse ausgeblendet, unter denen nicht nur die Bürokratie, sondern auch künstlerische und kulturelle Arbeit Tag für Tag operiert. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Situation wären auch in der Verwaltung personelle Veränderungen: mehr Frauen*, mehr BIPoC, schlicht ein realistisches Abbild unserer Gesellschaft in den relevanten Positionen.
4) Transparenz schaffen: Förderrichtlinien klar und verständlich darlegen
Auf Förderportalen finden sich meist ausführliche Aufstellungen darüber, wer unter welchen Voraussetzungen förderberechtigt ist, welche Kosten verrechnet werden dürfen und welche formalen Kriterien bei der Antragstellung eingehalten werden müssen. Weniger klar ist oft, von wem und nach welchen inhaltlichen Kriterien eine Entscheidung für oder gegen die Berücksichtigung eines Ansuchens getroffen wird. Das liegt oftmals daran, dass diese Kriterien nicht entsprechend formuliert sind, oder, falls doch, der Wunsch nach deren Umsetzung nicht in das tägliche Verwaltungshandeln eindringt. Kulturleitbilder und Kulturentwicklungspläne können noch so ambitioniert formuliert sein – solange sie nicht in Kriterienkataloge zur Förderung von KKA gegossen und umgesetzt werden, bleiben sie wirkungslos. Um Spannungen zu minimieren, ist eine ‚kluge‘, also serviceorientierte Transparenz notwendig. Wenn beide Seiten, also Kunst- und Kulturarbeiter*innen und Beamt*innen, sich auf Kriterienkataloge beziehen können und die Richtlinien für Antragsteller*innen leicht lesbar sind, ist hinsichtlich der Harmonie zwischen den beiden schon viel erreicht. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Kriterien flexibel bleiben, dazu braucht es so etwas wie Kriterienbeiräte, die diese regelmäßig reflektieren und gegebenenfalls aktualisieren.
5) Kulturarbeit professionalisieren: Anliegen fair, kompetent und selbstbewusst vortragen
Kunst- und Kulturarbeiter*innen müssen nicht die Verwaltung entlasten. Trotzdem haben auch sie die Möglichkeit, das Verhältnis zu Beamt*innen positiv zu beeinflussen. Dazu hilft es schon, die Beamt*innen nicht als Verhinder*innen, sondern als Ermöglicher*innen zu sehen. Die berühmte Idee der Augenhöhe bedeutet, sich nicht als Bittsteller*in zu sehen und trotzdem einen respektvollen Umgang zu suchen. Dabei hilft Klarheit über die eigenen Anliegen: Wer weiß, was er/sie braucht, kann selbstbewusst auftreten. Und wer nach erfolgreicher Zusammenarbeit auch zu den Beamt*innen ganz einfach einmal Danke sagt, hat schon viel zur Lösung von Spannungen beigetragen.
Selbstverständlich können die fünf genannten Maßnahmen nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Eine personelle Diversifizierung würde den positiven Effekt der inhaltlichen Entlastung von Beamt*innen auf deren Verhältnis zu den Kulturarbeiter*innen noch verstärken. Regionalisierung stärkt die Transparenz von Kriterienkatalogen genauso, wie jene von Förderentscheidungen und Genehmigungen. Und eine weitere Professionalisierung aufseiten der Kulturarbeiter*innen erleichtert den Zugang und verringert (gefühlte) Defizite gegenüber den Beamt*innen. All dies können erste Schritte in Richtung der Auflösung eines Spannungsverhältnisses sein, das bislang zu unnötigen Reibungsverlusten auf allen Seiten führte.
Literatur:
Theodor W. Adorno: Kultur und Verwaltung. In: Gesammelte Schriften, Bd. 8: Soziologische Schriften 1. 3. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, S. 122–146.
Eva Kreisky: Bürokratie und Politik. Band 1.: Beiträge zur Verwaltungskultur in Österreich; Habilitationsschrift, Universität Wien 1986.
Lust auf mehr?
Florian Walter ist im KUPFtalk mit Sigrid Ecker und Aliette Dörflinger in der KUPF Radio Show nachzuhören.
Außerdem ist er am 8. 10., 18:30 Uhr, im Studio 17 mit Dominika Meindl im MKH Wels bzw. auf dorfTV zu sehen.