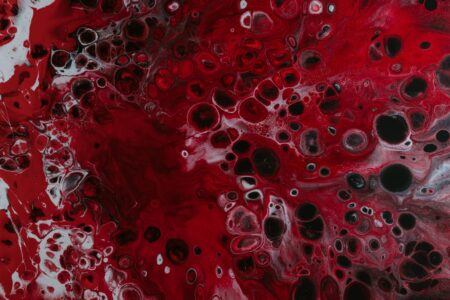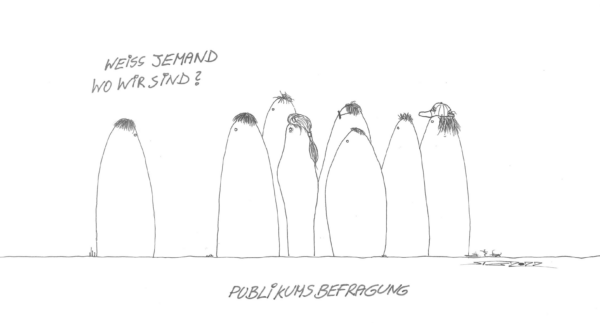Lisa-Viktoria Niederberger über Literaturstipendien, wirtschaftliche Sorgen, fütternde Hände und den Wunsch zuzubeißen.
Es gibt da einen Tag im Leben von uns eher jüngeren und eher mittel- bis unbekannten Schriftsteller*innen, den wir gleichermaßen herbeisehnen und verabscheuen. Wir, das sind vielleicht hundert Leute. Man kennt sich über eine, zwei, siebzehn Ecken, war mal gemeinsam bei einer Lesung. Jede*r sitzt in der Redaktion irgendeiner Literaturzeitung und hat jede*n schon mal veröffentlicht oder eben nicht. Man hat nach fünf Pfeffi am Messestand irgendeines hippen Berliner Lyriklabels in Leipzig mal geschmust oder über die Frage gestritten, ob Schreibschulen wie Hildesheim oder die Angewandte super oder doch scheiße sind. Und auch, wenn man sich da oft etwas schräg beäugt, irgendwie versteht man sich schon. Denn wir wollen ja alle das gleiche. Dass man uns liest. Vorher noch: dass man uns verlegt. Und noch vorher: dass wir es uns leisten können, zu schreiben. Da kommen dann die Stipendien ins Spiel. Und eins, auf das haben wir es alle ganz besonders abgesehen, ist das Startstipendium für Literatur. Denn: Das Startstipendium für Literatur ist heiß begehrt, bei uns „unter 35-jährigen österreichischen Staatsbürger*innen bzw. in Österreich Wohnenden, die über maximal eine selbstständige Publikation verfügen“ (so die Vergaberichtlinien). Es zugesprochen bekommen, bedeutet sechs Monate lang 1.300 € vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport. Es bekommen, bedeutet ein halbes Jahr schreiben können, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Und der Tag, den wir alle gleichzeitig herbeisehnen und verabscheuen, ist der Tag des E-Mails.
Als Reaktion auf das E-Mail, das mich grantig, traurig und mutlos macht, poste ich am 29. Juni dieses Jahres auf Facebook „Gescheiterte Versuche auf ein Startstipendium für Literatur: Vier. Gratuliere von Herzen, denen die …“ und bekomme dafür 8 Umarmungen, 6 Likes, 6 Herzen, eine findets lustig und einer findets traurig. In den Kommentaren sagt eine mittlerweile durchaus etablierte Autorin mit vielen Preisen, dass sie es 8 x nicht bekommen hat und „Irgendwer hat immer des Bummerl“. Dann kommen die Solidaritätsbekundungen, die „Ich auch nicht, mach dir nichts draus!“. Wir werden immer mehr, es geht das große Rätseln los, wenn wir alle nicht, wer dann? Gibt es etwa noch Autor*innen außerhalb unserer Bubble? Und als wir ihre uns unbekannten Namen dann auf der Homepage des Ministeriums lesen, fragen wir uns: Wer sind die? Was haben die, was wir nicht haben? Und: Reden sie über Geld? Was bedeutet das für sie, dieses Stipendium?
Ich erzähle eine Geld-Geschichte: Letzten Dezember hat mir unser Landeshauptmann eine Urkunde in die Hand gedrückt, die besagt, dass ich jetzt bis Ende 2021 die Literatur-Talentförderungsprämie des Landes Oberösterreich bekomme. Damit ich nicht alles auf einmal ausgebe, überweist mir das Land monatlich 225 €. Darüber, was das über den ideellen Wert hinter dieser Zahl aussagt – nämlich den Wert von dem, was man wohl ‚Nachwuchsliteratur‘ nennt, möchte ich nicht nachdenken müssen. Und ich würde niemals sagen, dass es wenig ist und eigentlich ein Witz, weil schon Edmund Burke sagte: „Never bite the hand that feeds you.“ Oder in meinem Fall: … that pays your Betriebskosten 24 Monate lang.
Weil: Kleinstbeträge hin oder her, in den vergangenen Monaten haben wir auch die wohl alle wieder zu schätzen gelernt. Manchmal ist es auch gar nicht notwendig, übers Geld-haben oder Geld-nicht-haben zu reden, es reicht ein aufmerksamer Blick ins eigene Smartphone.
Viel hat sich verändert in meiner Social Media Bubble in den letzten Monaten.
Unter meinen Facebook-Freund*innen tummeln sich Künstler*innen aller Sparten. Die wenigsten von ihnen sind so etabliert oder erfolgreich, dass sie genug Reserven haben, um die Corona-Monate ohne wirtschaftliche Sorgen zu überstehen. Die Einkommensquellen Lesung, Konzert, Performance, Theater sind weggefallen und die Versuche, den Verdienstentgang auszugleichen, sind manchmal skurril und unerwartet, aber offensichtlich immer notwendig.
Der DJ ist jetzt Fahrradkurier für eine Lieferdienst-App. Innerhalb von einer Stunde radelt er über 30 Kilometer in der Innenstadt, einen Thermorucksack mit heißen Speisen am Rücken. Statt Bildern von seinen Set-ups und Ausblicken ins tanzende Publikum teilt er jetzt via GPS-Tracker die Wege, die er beim Essensliefern zurücklegt und verschwitzte Feierabend-Selfies mit uns. Die Sportfotografin versucht, sich mit Pärchenfotoshootings ein zweites Standbein aufzubauen, weil sie mit den Absagen der großen Sportevents ihre Haupteinnahmequelle verloren hat. Mein Lebensgefährte und ich lächeln an einem verregneten Tag unsicher in die Kamera, damit sie ihr Portfolio erweitern kann. Die Frontfrau einer Coverband hat ohne Maturafeiern, Apres-Ski und Zeltfeste ebenfalls eine ihrer Einnahmequellen verloren. Sie erzählt jetzt auf Instagram viel über Gesichtsreinigung und die tollen Angebote einer Kosmetikfirma, von der ich noch nie gehört habe. Fasziniert schaue ich ihr zu, wie sie Make-up auf eine Erdbeere schmiert und dann mit einem elektrischen Reinigungsgerät wieder entfernt, ohne die Frucht zu beschädigen. Vor Corona hat sie es geschafft, hunderte junge Leute im Publikum dazu zu animieren mit ihr White Stripes zu singen, jetzt klingt sie, als würde sie schon ewig einen Teleshopping Kanal moderieren.
Die Burlesquetänzerin hingegen trainiert die letzten Monate mehr als zuvor. Sie wird, wenn es die Regeln erlauben, ein fulminantes Comeback feiern. Ich kann in meinem Feed quasi zusehen, wie ihre Rückenmuskulatur jeden Tag dickere Stränge bildet, gemeißelt wie von einem Bildhauer des römischen Barock. Und ich verstehe das Bedürfnis nach Bewegung. Ich bin Autorin. Ich bin Studentin. Ich arbeite im Kulturbereich. Seit März kann ich all diesen Beschäftigungen nicht nachgehen, nicht regulär zumindest. Seit März bin ich so viel zuhause, wie nie zuvor. Weil bei mir der Übergang vom Lockdown zur Sommerpause ein sehr fließender gewesen ist, kommt Normalität erst im Oktober. Auch ich mache täglich Yoga, es hilft nicht nur gegen das Kreuzweh vom vielen Ins-Zoom-Schauen in unergonomischen Haltungen, sondern auch gegen diese Blockaden im Kopf. Schwitzen nimmt Angst und das Dehnen zieht die Schwere von der Seele. Und trotzdem würde ich lieber wieder die inspirierte Autorin statt den herabschauenden Hund machen.
Es mag Schriftsteller*innen geben, denen Isolation nichts ausmacht, die sich ihr sogar freiwillig hingeben. Ich bin nicht so, ich bin eine Kaffeehausschreiberin, ich mag Bibliotheken und Inputs von außen. Ich glaube, ich trage gute Geschichten nicht in mir, sondern ich finde sie auf der Straße, hebe sie auf, und kümmere mich dann daheim liebevoll um sie. Dieser Corona-Mix aus Angst, Geldsorgen, Homeoffice, Distance learning und die Reduktion meiner sozialen Kontakte: Das ist Gift für meine Kreativität. Blöd nur, wenn mein Kontostand von meiner Kreativität abhängig ist.
Ich glaube, wirklich unbeschwert Kunst machen kann nur, wer frei von wirtschaftlicher Sorge ist. Kann nur, wer nicht tagsüber einer komplett hirnlosen Lohnarbeit nachgehen muss und dann abends eine Stunde vorm Manuskript sitzen, auf Kommando quasi, irgendwann zwischen Abendessen und Ins-Bett-Gehen. Wer vom Schreiben leben können will, braucht erst genug Geld zum Leben, um Schreiben zu können. Und weil es nie genug Sonderfonds und Stipendien und Residencies und was-weiß-ichs geben wird – zum Wohle aller, aber eben auch deswegen, weil die Kunst- und Kulturproduktion nicht nur Privilegierten vorbehalten sein darf: bedingungsloses Grundeinkommen, bitte.
Lust auf mehr?
Am 8. 10., 18:30 Uhr, ist Lisa-Viktoria Niederberger im Studio 17 mit Dominika Meindl im MKH Wels — zu sehen auf dorfTV.