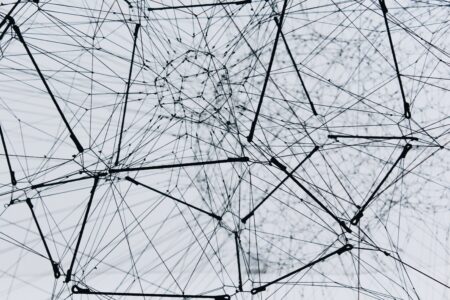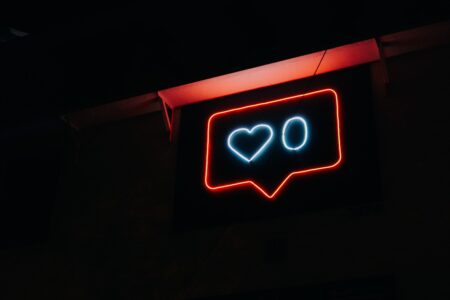Anita Moser über eine kultur- und demokratiepolitische Notwendigkeit.
Die Coronakrise führt soziale Ungleichheit und Trennlinien drastisch vor Augen: zwischen gut Situierten, die es sich leisten können, den Lockdown als Entschleunigung zu erleben, und sozial schlechter Gestellten, deren existenzielle Nöte sich vervielfachen und die noch stärker als sonst von gesellschaftlicher Teilhabe und Ressourcen abgeschnitten sind. Nicht mehr zu übersehen ist die patriarchale Verfasstheit unserer Gesellschaft: Nährboden für Mehrfachbelastungen von Frauen, deren Prekarisierung und nicht zuletzt für Gewalt an Frauen und Kindern. Die Krise fördert auch Ausgrenzungen und Rassismen zutage, etwa wenn Personen aufgrund zugeschriebener Fremdheit oder prekärem Aufenthaltsstatus von Ressourcen und Kommunikation ausgeschlossen werden. Die real bestehende Vielheit unserer Gesellschaft bildet sich nicht in den öffentlichen Institutionen und verschiedenen gesellschaftlichen Feldern ab. Definitions-, Mitbestimmungs- und Entscheidungsmacht sind bestimmten privilegierten Kreisen vorbehalten. Dies alles ist nicht neu, zeigt sich aktuell aber besonders deutlich. Die Coronakrise ist also die Krönung einer lange bestehenden, umfassenden Krise unserer Demokratie.
Der Kulturbetrieb spiegelt soziale Ungleichheiten und Ausschlüsse wider
Auf Ebene des Personals – insbesondere in Leitungspositionen – sind Frauen, LGBTIQs, als ‹fremd› angesehene Personen und andere diskriminierte Gruppen selten bis gar nicht anzutreffen. Auch Inhalte und Programme des Kulturbetriebs richten sich immer noch primär an ein ‹weißes›, akademisch gebildetes Publikum. Das zeigt sich umso deutlicher, je mehr man in Richtung etablierter Institutionen blickt. Fatal wäre es nun, als kulturpolitisches Post-COVID19-Ziel lediglich das Überleben des Kulturbetriebs und seiner Akteur*innen anzuvisieren. In Anbetracht der Tatsache, dass in unserer Gesellschaft demokratische Errungenschaften ohnehin bedroht sind und eine Demokratisierung des Kunst- und Kulturfeldes nach wie vor aussteht, sollte es gerade jetzt darum gehen, einen kritischen Blick auf das System zu richten, Schwachstellen zu analysieren und neue Perspektiven und Modelle zu entwickeln.
Eine demokratische und diskriminierungssensible Kulturpolitik
Es braucht also eine gesellschaftlich verantwortliche Kulturpolitik, die auf allen Ebenen des Kunst- und Kulturbetriebs Diversität und breite Teilhabe mitdenkt, einfordert und finanziell fördert, sodass Mitglieder diskriminierter Gruppen sich selbstbestimmt einbringen und mitentscheiden können. Unerlässlich sind dabei Schwerpunktsetzungen sowie eine budgetäre Umverteilung hin zu selbstorganisierten und soziokulturellen Initiativen der Freien Szene(n), die demokratisches Ausverhandeln und gemeinsames künstlerisches, kulturelles und gesellschaftliches Gestalten aktivieren. Wichtig ist auch die Förderung von interdisziplinären Kooperationen und von Solidarisierungen, etwa zwischen etablierten und freien Einrichtungen. Verstärkt in den Fokus öffentlicher Finanzierung sollten zudem künstlerisch-kulturelle Formate rücken, die zivilgesellschaftliches Engagement stärken, Benachteiligte begünstigen, mit Formen der Erneuerung von Demokratie experimentieren sowie emanzipatorische Anliegen verfolgen. Es braucht verbindliche Standards für gerechte Bezahlung und soziale Absicherung von Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen. Außerdem sind transparente, unbürokratische und niedrigschwellige Förderungen sowie breite Unterstützung für von Ausschlüssen betroffene Akteur*innen erforderlich.
Selbstkritisches Hinterfragen und Umbau kulturpolitischer Strukturen
Unerlässliche Basis einer demokratischen und diskriminierungssensiblen Kulturpolitik ist die (selbst-) kritische Analyse und schrittweise diversitätsorientierte Änderung der gesetzlichen Grundlagen und Entscheidungsgremien; und das in Zusammenarbeit mit diskriminierten Gruppen. Der Umbau staatlicher Strukturen muss auch mit der Schaffung neuer Organisationen – wie Beratungsstellen für Diversitätsentwicklung – einhergehen.
Zu hoffen ist, dass die neue Kulturstaatssekretärin und ‹ihr› Minister demokratiepolitische Anliegen ernst nehmen und diesbezügliche Potenziale des Kulturfeldes sehen und stärken. Auch, dass das Feld auf Regierungsebene größeren Wert und letztlich ein eigenes, gut dotiertes Ministerium erhält. Denn, wenn das fehlt – auch das zeigt die Coronakrise –, können weder Überlebensmaßnahmen für Kunst und Kultur umgesetzt, noch vorausschauende, mutige kulturpolitische Konzepte entwickelt werden.