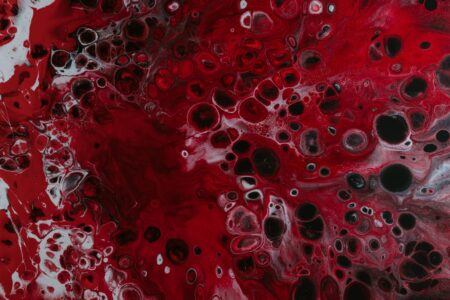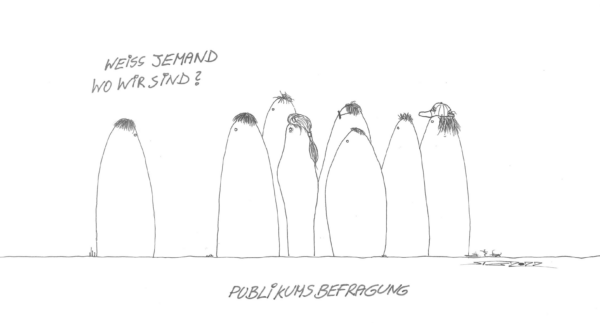Immer wieder findet das Narrativ der „Krise als Chance“ Eingang in politische Statements. Eine Chance für wen? In der krisenerprobten Kunst- und Kulturarbeit koexistieren Alltag und Angst während der Coronakrise weiter, berichtet Nicole Schöndorfer.
Manche Aspekte, um die es in diesem Text geht, werden sich bis zum Redaktionsschluss verändert haben. In der Kulturpolitik tut sich viel. Es werden Termine zur Wiedereröffnung nach der Schließung sämtlicher Kunst- und Kulturstätten Mitte März angekündigt und verschoben. Die Branche ist verärgert über die Kommunikation der politischen Verantwortlichen und wünscht sich vor allem Planungssicherheit. Lange Zeit hieß es, dass Kinos, Theater und Co. erst Ende Juni aufsperren könnten, deshalb haben viele Einrichtungen die Wochen bis dahin geplant, Veranstaltungen abgesagt, neue Projekte auf Eis gelegt oder umgestaltet. Als es hieß, dass es doch einen Monat früher wieder mit eingeschränktem Betrieb losgehen könnte, wurden viele nervös: Wie so schnell alles vorbereiten? Es braucht Vorlaufzeit, um alles auf Schiene zu bringen. Auch die Mitarbeiter*innen müssen eingesammelt und auf den neuesten Stand gebracht werden. Es müssen technische Anpassungen und eventuell Renovierungen der Lüftungsanlagen durchgeführt werden.
Keine politische Lobby
In der Kunst- und Kulturszene gibt es keine Homogenität, was Bedürfnisse angeht. Die Bundestheater in Wien haben andere Einbußen aufzuarbeiten als kleine Kulturvereine in Oberösterreich. Das autonome Kellertheater muss Bühne und Saal anders umgestalten als die Staatsoper. Die selbstständige Performance-Künstlerin, die von einer Projektförderung zur nächsten arbeitet, hat andere Probleme als der Filmemacher mit dem Arbeitsstipendium oder die angestellte Musikerin im Homeoffice. Alle brauchen etwas anderes, doch das war immer schon so und kann daher keine Ausrede für das Desinteresse der Regierung sein. ‹Kulturnation› Österreich! Aber nur, wenn sich die Beteiligten entweder um sich selbst kümmern, oder wenn sie eine für den Wirtschaftsstandort Österreich erhebliche finanzielle Leistung in Kombination mit Gastronomie, Sport und Tourismus bringen, was eher weniger mit feministischen und herrschaftskritischen Kunst- und Kulturformen einhergeht, sondern mit traditionellen und konservativen Angeboten. «Es gibt keine konkreten politischen Bekenntnisse», sagt Oona Valarie Serbest, Geschäftsführerin der Vernetzungsstelle FIFTITU% in Linz, die sich mit Beratung und Aufklärungsarbeit für bessere Bedingungen für Kunst- und Kulturarbeiter*innen einsetzt. «Es heißt zwar, es wird niemand zurückgelassen, aber viele erhalten nach wie vor keine Unterstützung. Es zeigt sich, welchen Stellenwert diese Personen für die Bundesregierung haben», sagt Serbest.
Die Kunst- und Kulturszene scheint in der Krisenpolitik also keine politische Lobby zu haben. Insbesondere außerhalb der klassischen Strukturen, die etwa für finanzielle Hilfen aus dem Härtefallfonds der Regierung notwendig wären. Also in Szenen, in denen atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse regulär sind. Dort sind Kunst- und Kulturarbeiter*innen auf sich selbst bzw. auf Wissen und Stimmen von Verbänden und Interessenvertretungen wie KUPF OÖ und IG Bildende Kunst angewiesen. «Ich bin dankbar für das kulturpolitische Engagement, das sie betreiben. Den politischen Verantwortlichen kann nur geraten werden, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um schnelle Lösungen zu finden», sagt Serbest. Es fällt auf, wie Interessenvertretungen darauf bedacht sind, Informationen zu Beihilfen, Anträgen und Updates zu politischen Maßnahmen niederschwellig und gesammelt online zugänglich zu machen und tagesaktuell zu halten.
Wachsame Szene
Sich um sich selbst kümmern zu müssen, ist in der Kunst- und Kulturarbeit keine unmittelbare Folge der Coronakrise, sondern Alltag. Alle sind krisenerprobt. Gerade in der Freien Szene, die kaum überraschend weiblich dominiert ist, sind Unsicherheiten und existentielle Ängste kein Merkmal einer Ausnahmesituation, sondern ständige Begleiter*- innen. Vielleicht ein Mitgrund für ihren fast unaufgeregten Umgang mit der Situation. Es werden jene Kräfte gebündelt und mobilisiert, die aufgrund der prekären Lebenssituation ohnehin an der Tagesordnung stehen. Das ist gut, aber natürlich kein Zustand in einem Land, das die Vielfalt seiner Kunst- und Kulturarbeitenden sonst stolz vor sich her trägt.
Während Geld aus den von der Regierung bereitgestellten Krisentöpfen also weniger an die Freie Szene geht, auch, weil die bürokratischen Hürden dafür sehr hoch sind, scheint die Zusammenarbeit mit den Fördergeber*innen entspannt. Laut Ulrike Kuner, Geschäftsführerin der IG Freie Theater, ist die Szene zwar wachsam, weil die Künstler*innen und Kollektive überlegen müssen, wie sie ihre begonnenen und zum Teil bereits geförderten Projekte unter den neuen Umständen realisieren können. Aber die zuständigen Sektionen würden flexibel mit Konzeptadaptionen umgehen. «Gut für die Künstler*innen der Freien Szene ist auch, dass sie tendenziell unabhängiger von Räumen sind. Nun ist das trotzdem eine schwierige Situation, aber ich traue ihnen zu, dass sie in der Lage sind, ihre Stücke kreativ umzugestalten, wenn sie das möchten», sagt Kuner.
Weitermachen
Man sei außerdem sehr aktiv, weil die Krise guten Stoff liefere. «An Ideen mangelt es mit Sicherheit nicht», sagt Kuner erfreut, die auch Online-Aktivitäten von Künstler*innen, wie etwa Instagram-Lesungen, Wohnzimmerkonzerte und behind the scenesClips als gute Ergänzung empfindet. «Das hat mit Publikumsbindung zu tun», sagt sie und sieht dadurch die Bereitschaft des Publikums wachsen, wieder ins Theater zu gehen. «Es gibt Umfragen, da wurde erhoben, ob die Leute wieder ins Theater gehen würden, wenn sie dürften. Ende April haben 65 Prozent verneint und Mitte Mai waren es nur noch halb so viele.»
In der Kunst- und Kulturarbeit, insbesondere in der Freien Szene, herrschen also Unsicherheit und Ärger über die Regierungspolitik vor (wobei das nicht direkt mit der Coronakrise zu tun hat), aber auch Motivation und Freude an Kunst, Kultur und der Arbeit damit. Das «Krise als Chance»-Narrativ passt jedenfalls nicht auf die Branche, denn sie macht, was sie immer gemacht hat: weiter.