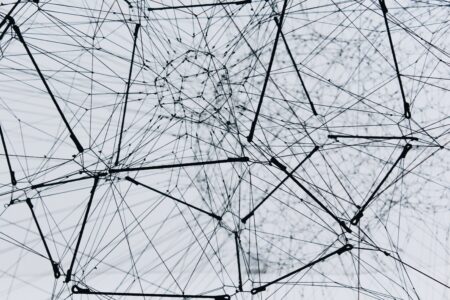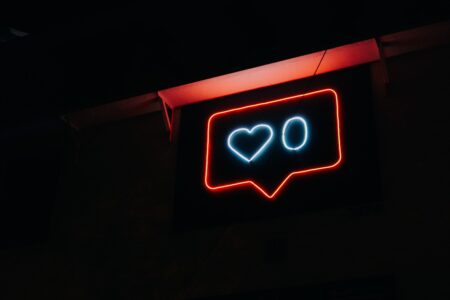Irgendwann ist nach der Krise. Die Arbeitsbedingungen für Kulturarbeiter*innen waren schon vor der Pandemie prekär — anstatt diesen Zustand wiederherzustellen, müssen wir darüber hinaus wachsen, fordert Anna Fessler.
Covid-19 hat die Arbeitssituation vieler Menschen stark verändert. Gibt es meinen Job nächsten Monat noch? Muss ich arbeitslos mit der Hälfte des Geldes auskommen? Langfristige Planung wird unmöglich, Existenzsorgen belasten die Psyche. Die Einnahmen sind geringer, die Ausgaben dieselben. Nun stellen Sie sich vor, diese Situation wäre keine temporäre, sondern ab jetzt Ihr Arbeitsalltag. Willkommen in der Kulturarbeit.
Als Dank für Ihre Bemühungen wird Österreich in besseren Zeiten als Kulturnation gelobt, wenn es aber um faire Arbeitsbedingungen für den Kunst- und Kultursektor, adäquate Fördersummen und die Erhaltung der Kulturlandschaft geht – *Grillenzirpen*.
Die Politik weiß längst, was zu tun ist, beinahe gebetsmühlenartig wiederholen die Interessenvertretungen und Kulturarbeiter*innen ihre Forderungen. Kleine Einzelerfolge wurden dadurch eingeholt, strukturell ändert sich nichts. Häufig wird dies mit fehlendem Geld gerechtfertigt.
Kein Geld für Kunst und Kultur?
Der Kunst- und Kultursektor wird gerne als Tüpfelchen auf dem i gesehen. Tatsächlich ist er Wirtschaftsfaktor mit ca. 6 Mrd. jährlicher Wertschöpfung. Die Finanzen scheinen vorhanden zu sein, wie der Fall KTM zeigt. Aber sogar, wenn man beim Argument des fehlenden Budgets bleiben will: Geld ließe sich auch umverteilen. Vermögens- und Erbschaftssteuern sowie eine ausgewogene Verteilung der Förderungen zwischen Kulturtankern und Freier Szene rufen jedoch bei vielen Entscheidungsträger*innen die Angst hervor, sich unbeliebt zu machen. Sich beliebt zu machen ist aber nicht ihre Aufgabe, sondern als Staatsdiener*innen im besten Interesse der Bevölkerung zu handeln. Was nur bedeuten kann, eine vielfältige Kulturlandschaft zu ermöglichen.
In der Freien Szene scheint Resignation zu herrschen: Man arbeitet weiter unter unzumutbaren Bedingungen, weil es immer schon so war, weil man von der Sache überzeugt ist, weil man es irgendwie über die Runden schafft – und für die Kultur brennt. Und vielleicht auch, weil in regelmäßigen Abständen Brotkrumen zugeworfen werden, die kurzfristige Erleichterungen schaffen.
Damit sollten wir uns aber nicht zufrieden geben. Das Ziel kann nicht sein, den Status quo vor Corona zu erreichen. Die miserablen Zustände auf die Pandemie zu schieben und sich danach als Kulturinitiative über das wirtschaftliche Überleben zu freuen – darin besteht eine große Gefahr.
Wir müssen ambitionierter denken, an eine fair bezahlte Kulturarbeit mit langfristigen, sicheren Anstellungen und entsprechender Wertschätzung. Das ambitioniert zu nennen verdeutlicht, wie schlimm die Lage ist: Diese Konditionen sollten selbstverständlich sein.
Keine Welt ohne Kunst und Kultur!
Dazu braucht es neben einer grundlegenden Reform des Förderwesens und einer Erhöhung des Förderbudgets:
• solide Daten zur Situation der Kulturarbeiter*innen und zum Finanzierungsbedarf
• arbeitsrechtliche Vorgaben und verbindliche Mindeststandards der Honorierung in der freien Kunstund Kulturarbeit
• Einbeziehung von Expert*innen/Interessenvertretungen / Kulturarbeiter*innen in Entscheidungsprozesse
Und so ehrenwert es auch sein mag, wenn jemand für den Beruf brennt und zu schlechten Bedingungen arbeitet – so trägt er/ sie zur Problematik ein Stück weit bei. Es ist wichtig, klare Grenzen zu ziehen, die Latte liegt hier viel zu niedrig.
Kulturarbeiter*innen müssen den Wert ihrer Arbeit auch selbst sehen, ihn immer wieder einfordern. Erstmals steht Fair Pay im Regierungsprogramm – darauf darf die Bevölkerung in der Zeit nach der Pandemie keinesfalls vergessen und muss darauf bestehen. Die letzten Monate waren eine Vorschau auf eine Welt ohne Kulturveranstaltungen. Wem sie nicht gefallen hat, soll solidarisch für ein Ende der prekären Verhältnisse in allen Branchen einstehen.
Weiterführende Literatur: Pierre Bourdieu, Prekarität ist überall (1997)