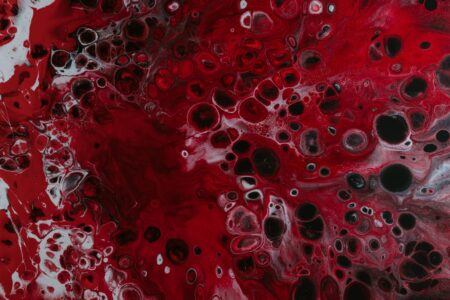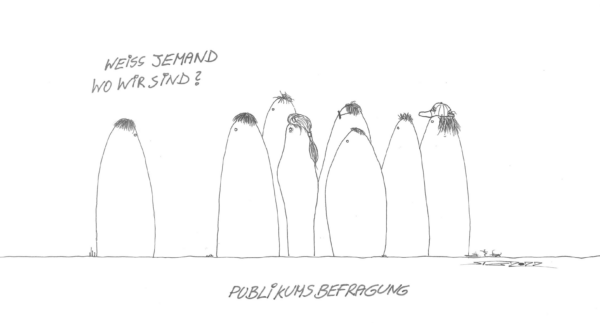Nein zu sagen, so heißt es in einem Interview mit dem französischen Philosophen Michel Foucault von 1978, sei nicht einfach ein Akt der Verweigerung oder die Negation einer der beiden Pole einer zweiwertig gestrickten Dialektik. Nein zu sagen, so Foucault, sei vielmehr Resultat einer Haltung, die aus dem Widerstand gegen all jene Formen der Führung kommt, die sich kurz vor Beginn der Reformation in Europa ausgebreitet haben. Heute meint man damit vor allem gouvernementale Imperative, seit den Achtzigern des vergangenen Jahrhunderts zählen Körperpraktiken zur Selbstoptimierung – Fitness, Yoga, Triathlon – dazu. Im 15. Jahrhundert oblag das Handwerk der Gewissensführung – die Griechen nannten es ‹techne technon›, also Kunsthandwerk – noch kirchlichen Autoritäten: Mithilfe von Regeln, Vorschriften, dem Abringen von Geständnissen und der Verpflichtung auf das Sprechen der Wahrheit wurden erste Techniken der Menschenführung etabliert.
Kulturelle Milieus – so macht es oft den Anschein – sind selbst geschaffene Paradiese mit Mitbestimmungsrecht und Teilautonomie, die von Techniken der Macht und des Gehorsams kaum berührt zu sein scheinen. Sie versprechen ein aufs Selbst zentriertes Leben mit kreativen Herausforderungen und öffentlicher Präsenz, abgefedert durch ein dichtes Netz an Stipendien, die den Anspruch auf Unabhängigkeit dennoch nicht schmälern. Vom Wetterwendischen des freien Marktes geschützt, können freie Produzent*innen an ihrem ganz persönlichen, nächsten großen Ding arbeiten, sie müssen sich nur gut regieren und regelmäßig etwas vorweisen. Sich dieser Regierungskunst zu unterwerfen, heißt auch, über Jahre hinweg in stillen Kammern zu sitzen und einen Stil zu entwickeln, literarisch zu beichten, diesmal nicht vor Patern, aber mit der selbstverfassten Heiligen Schrift in den Händen. Sich dieser zeitgemäßen Selbsttechnik zu widersetzen, könnte indes ein Akt des Widerstandes sein – und damit Teil der von Foucault als Kritik bezeichneten «Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden». Abseits des lebenslangen Staatsstipendienpaternalismus für die Wenigen könnte längst jede*r, einem bekannten Ausspruch von Andy Warhol folgend, fünfzehn Minuten lang ein Star sein: Heute bist es Du, morgen kann es ein*e andere*r sein.