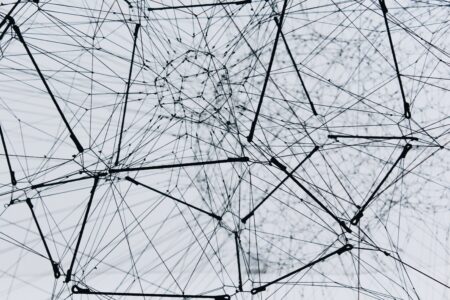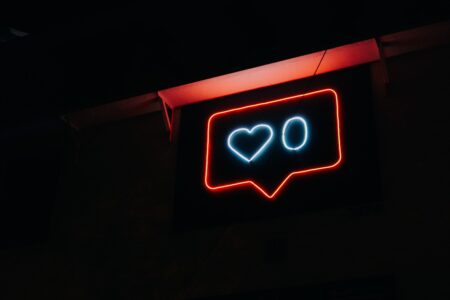Feministische Aktivistinnen kämpfen seit Jahrzehnten für Klimagerechtigkeit – denn die Auswirkungen des Klimawandels treffen Frauen im globalen Süden am härtesten. Brigitte Theißl analysiert diese geschlechterpolitische Dimension der Klimakrise.
Ende Juli reichten User*innen ein Facebook-Posting von Martina Salomon durchs Netz: «Der heurige Wein wird gut, der Tourismus freut sich, die Gemüse-Ernte ist ausgezeichnet. (…) Ich freu mich, am Abend auch einmal ohne Jackerl beim Heurigen sitzen zu können – und ärgere mich nur über zu kalt gedrehte Klimaanlagen», ließ die Kurier-Chefredakteurin ihre Leser*innen wissen und empörte sich über die «Kriegsberichterstattung» zur Sommerhitze im ORF trotz «Verständnis für das Klimathema». Ein Posting, das – vermutlich unbeabsichtigt – den privilegierten Blick im kühlen Norden auf die Klimakrise geradezu beispielhaft demonstriert. Dass dieser auch hierzulande die Schlagzeilen wochenlang dominierte, liegt wohl auch an den sommerlichen Rekordtemperaturen, die Österreich überdurchschnittlich viele Tropennächte bescherten. Stickige Büros oder zubetonierte Hitzepole lassen den menschengemachten Klimawandel vor allem Stadtbewohner*innen spürbar werden und machen radikal deutlich: Zu lange schon ist Klimapolitik als Special-Interest-Thema für Umweltschutzorganisationen auf die lange Bank geschoben worden.
Nord-Süd-Achse
Mit den Temperaturen steigt also die Sensibilität für Klimafragen – und es bleibt zu hoffen, dass diese auch über die eigene Dachgeschosswohnung hinausgeht. Die Klimakrise kennt schließlich keine Grenzen, sondern stellt eine globale politische Herausforderung dar und trifft verschiedene Weltregionen in ganz unterschiedlichem Ausmaß. Gerade jene Nationen, die mit einem geringen CO2-Ausstoß vergleichsweise wenig zum sich beschleunigenden Klimawandel und der damit einhergehenden Erderwärmung beigetragen haben – afrikanische, südamerikanische Länder und pazifische Inselstaaten –, bekommen die Auswirkungen am härtesten zu spüren: Dürren, Wassermangel, Verwüstung, aber auch Überschwemmungen haben bereits tiefe Spuren hinterlassen. Wie eine aktuelle, in der US-amerikanischen Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte, Studie zeigt, wäre die ökonomische Ungleichheit zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern der Erde – betrachtet man den Zeitraum zwischen 1961 und 2010 – ohne den Klimawandel um 25 Prozent geringer.
Geschlechtsspezifische Folgen
Dass diese globale Ungerechtigkeit auch eine brisante feministische Frage ist, machen Aktivistinnen und Wissenschafterinnen – allen voran im globalen Süden – schon seit Jahrzehnten zum Thema ihrer politischen Kämpfe. Etwa Aktivistinnen wie Wangari Maathai, die kenianische Umweltaktivistin und Frauenrechtlerin, die 2004 als erste afrikanische Frau den Friedensnobelpreis erhielt: «Klimawandel bedeutet Leben oder Tod. Wir könnten beschuldigt werden, alarmistisch zu sein, aber wenn wir der Wissenschaft glauben, dann passiert gerade etwas sehr Ernstzunehmendes» (Übers. Red.), zitiert die britische Tageszeitung The Guardian die ehemalige Politikerin und Wissenschafterin 2009. Maathai gründete bereits in den 1970er Jahren das Green Belt Movement, das ausgehend von den schwierigen Lebensbedingungen kenianischer Bäuerinnen Umweltschutz, Armutsbekämpfung und Frauenrechte zusammendachte und sich der Abholzung der Wälder entgegenstellte. Generell gilt: Ob Naturkatastrophen wie Tsunamis oder Wasserknappheit und ausgelaugte Böden – stets treffen die langfristigen Folgen Frauen besonders hart. Sie sind es, die lange Wege zu einer Wasserquelle zurücklegen und dabei Übergriffe erleben. Sie sind es, die nach Katastrophen zurückbleiben und sich um alte und kranke Menschen kümmern.
Mother Nature?
Im Westen waren es zunächst Vertreterinnen eines Ökofeminismus, die an die Ideen der Graswurzelbewegungen anknüpften und in den 1980er Jahren gegen Atomkraft, Kriegstreiberei und Umweltzerstörung auf die Straße gingen. Ökofeministische Theoretikerinnen stellten die Systemfrage und zugleich die Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen im Patriarchat jener der Natur gegenüber. «Eines meiner Hauptanliegen ist es, aus einer mechanischen, männlich dominierten Weltsicht auszubrechen, die bereits durch die Theorien von Newton, Bacon und Descartes definiert wurde. Die Welt wurde als Maschine begriffen, die Natur galt als tot und Frauen als leere Gefäße», so formuliert es die bekannte Umweltaktivistin Vandana Shiva 2016 in einem Interview mit dem feministischen Magazin an.schläge. Die Dualismen Mensch-Natur und Mann-Frau prägen unser Denken ebenso wie unsere Ökonomie und unser Rechtssystem, analysierten feministische Denkerinnen und schlussfolgerten: Die Naturnähe, die Frauen zugeschrieben wird («Mutter Erde»), befähige sie wiederum zur Gestaltung einer radikalen wie vernünftigen Umweltpolitik, so etwa die australische Soziologin und Ökofeministin Ariel Salleh.
Kritik an einem Ökofeminismus, der selbst essentialistisches Denken verfestige und technologischer Entwicklung oft skeptisch bis ablehnend gegenüber stehe, wurde spätestens in den 1990er Jahren mit einer Ausdifferenzierung feministischer Theorie laut.
Dennoch erweisen sich ökofeministische Ideen auch heute noch als anschlussfähig, wenn es darum geht, fundamentale Kritik an einer globalen Wirtschaftsordnung zu üben, die Profite über Ressourcenschonung und das gute Leben für alle stellt. Kapitalismuskritik und Klimapolitik gehen feministisch meist Hand in Hand und sind so auch Teil der Vision eines gesellschaftlichen Wandels, den die wachsende Frauenstreik-Bewegung vorantreiben will. Dass eine Klima-Bewegung dem herrschenden System niemals nur einen grünen Anstrich verpassen darf, bekräftigte Naomi Klein, kanadische Autorin und populäre Stimme der nordamerikanischen Linken, in ihrem 2014 erschienenen Buch This Changes Everything. «Die wirklich unbequeme Wahrheit ist, dass es nicht um Kohlenstoff geht – sondern um Kapitalismus. Die bequeme Wahrheit ist, dass wir diese existenzielle Krise nutzen können, um unser gescheitertes System zu transformieren und etwas radikal Besseres zu bauen» (Übers. Red.), schreibt Klein. Feministische Ideen für den radikal besseren Entwurf liegen genügend auf dem Tisch.