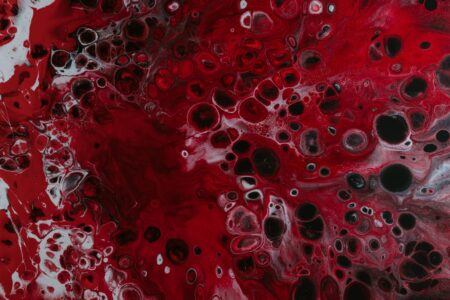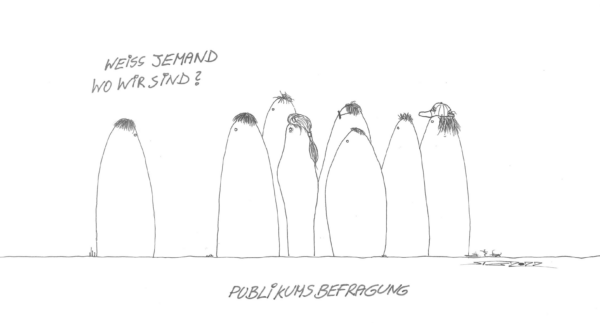Von Musik über Schauspiel bis zum Mediendesign – das künstlerische Feld ist von Vielfalt gekennzeichnet. Deutlich weniger vielfältig ist die soziale Zusammensetzung der Studierenden an den Kunstuniversitäten. Künstlerische Studien, und mit ihnen das künstlerische Feld insgesamt, haben den Ruf, eine Angelegenheit für privilegierte Rich White Kids zu sein. Ob dieses Bild der Realität entspricht und was gegebenenfalls dagegen getan werden kann, besprechen Sophie Vögele und Philippe Saner im Interview mit Florian Walter.
Florian Walter: Als „Auswahl der Auserwählten“ beschreiben Sie in Ihrer Untersuchung die Aufnahmeverfahren an Kunsthochschulen. Wer wird an einer Kunstuni aufgenommen, wer nicht?
Sophie Vögele und Philippe Saner: Schweizer Kunsthochschulen setzen aus privilegierten Verhältnissen stammende, weiße, schweizerische, heterosexuelle Personen mit leistungsstarken, jungen und gesunden Körpern als Norm. Alles, was davon abweicht, wird als anders definiert. Der Zugang für ethnisch markierte und aus weniger privilegierten Verhältnissen stammende Leute ist nur sehr erschwert möglich.
Gibt es Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten mit anderen Studien und Universitäten?
Die Schweizer Tradition der Kunstgewerbeschule hat sich lange durch die Zugänglichkeit für Kinder aus Arbeiter*innen- und Handwerker*innenfamilien ausgezeichnet – wobei allerdings Frauen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts marginalisiert blieben. Heute gleicht die Herkunft der Studierenden an Kunsthochschulen denen von traditionellen Elite-Ausbildungen wie Rechtswissenschaften oder Medizin. Ein wichtiger Grund für diese exklusive Zusammensetzung sind die strengen Aufnahmeverfahren, die sonst nur in der Medizin vorzufinden sind. Um diese bestehen zu können, bedarf es der jahrelangen künstlerischen Praxis und Vorbereitung.
Um im Kulturbereich erfolgreich zu sein, braucht man ein finanzstarkes Elternhaus, muss sich in Kunstdiskursen mitteilen können und auf ein Netzwerk im Kunstbetrieb bauen können. Stimmt das?
Die Eltern der Studierenden an Kunsthochschulen sind überwiegend Künstler*innen, Lehrpersonen, Akademiker*innen. Sie üben Berufe aus, die später auch die Absolvent*innen von Kunsthochschulen ergreifen werden. Gesamtgesellschaftlich betrachtet: Hier reproduziert sich eine soziale Klasse.
Ist die Ungleichheit an Kunstuniversitäten nur eine Fortsetzung der Auswahl in den Kindergärten und Schulen?
Die Kunsthochschulen können aus den bereits vorausgewählten Kandidat*innen auswählen – «Es kommt bereits alles gemacht», wie es ein Dozierender formulierte. Der soziale Ausschluss nimmt von Bildungsstufe zu -stufe zu, er bildet die elterlichen Bildungshintergründe und deren Berufsklassen ab. Die verschiedenen Vorläuferinstitutionen – künstlerische Gymnasien, Vorkurse und Vorstudium etc. – sind oft miteinander verknüpft, es bestehen auch personelle Austauschbeziehungen, «man kennt sich».
Hochschulstudien werden zusehends internationaler. Welche Folgen hat das für Kunstuniversitäten?
Die vermehrte Rekrutierung von sogenannten ‚internationalen Studierenden‘ trägt deutlich zu einer Verstärkung der bestehenden sozialen und kulturellen Ungleichheiten bei. Studierende mit transnationalen Biografien, die sich in verschiedenen Sprachen eloquent im Kunstfeld bewegen können, sind gerne gesehen. Wie auch die Studie von Barbara Rothmüller zur Akademie der bildenden Künste Wien gezeigt hat, sind ökonomisch gut situierte Studierende aus EU-Mitgliedstaaten deutlich übervertreten. Die zunehmende Internationalisierung wird also Folgen für den Kunstbetrieb haben.
Wie haben sich Zugangsbarrieren an Kunstunis entwickelt?
Wir konnten die Zugangsbarrieren nicht in einer historisch-vergleichenden Perspektive untersuchen. Aber: Eine Zunahme von Studierenden aus sozio-ökonomisch privilegierten Milieus mit hohem kulturellen Kapital deutet sich an – insbesondere in den stark internationalisierten Bereichen der Kunsthochschulen, wie der klassischen Musik und der bildenden Kunst. Schauspiel mit seinem Fokus auf die deutsche Sprache, Design und künstlerische Vermittlung (Lehramt) in geringerem Ausmaß, weil diese noch stärker auf hiesige Kunst- bzw. Arbeitsmärkte ausgerichtet sind.
Warum überhaupt sollten Arbeiter*innenkinder an die Kunstuni wollen, wenn danach ein prekäres Künstler*innenleben auf sie wartet?
Kunsthochschulen sollten – wie auch Museen, Theater oder Opernhäuser – als öffentlich finanzierte Bildungsinstitutionen für alle zugänglich sein. Gerade im Wissen um die soziale Selektivität sollten die Institutionen an der Öffnung und Demokratisierung der Zugangswege und auch an ihren eigenen Strukturen arbeiten.
Wie können die Zugangsbarrieren verringert werden? Gibt es dazu Bestrebungen? Oder will man ohnehin lieber unter sich bleiben?
Wir haben in unserem Abschlussbericht auf Handlungsfelder hingewiesen, die von den Aufnahmeverfahren – Zugang zu Information, finanzielle Anforderungen, Auswahlkriterien – über die Curricula und die Bedingungen während des Studiums bis hin zu den Organisationsstrukturen und Politiken der Hochschulen reichen.
Leider hat sich sehr großer institutioneller Widerstand gezeigt. Dabei sollte eine zeitgemäße, kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Vielfalt Kerninhalt der institutionellen Hochschul- und Qualitätsentwicklung werden. Langfristig würde eine Uni dadurch international besser sichtbar, die Zahl der Bewerber*innen würde steigen.
Die Hochschulen unterstützen bisher diese Initiativen nicht, obwohl das ziemlich exakt auf die Formulierung ihrer strategischen Ziele passt. Sie haben sich – wenn überhaupt – lediglich mit den «technischen Fragen» wie der Formulierung von Aufnahmekriterien beschäftigt. Es scheint, sie wollen die eigenen Privilegien sichern und die bestehenden Machtverhältnisse wahren.
Welche Handlungsaufträge ergeben sich für Kulturhäuser, Theater, Museen, etc.?
Eine kritische Auseinandersetzung mit Machtverhältnissen im Kunstfeld und in der Gesellschaft ist notwendig. Diese sollte weder an künstlerische Produktionen, noch an die institutionell schwach positionierten Gleichstellungs- bzw. Diversity-Fachstellen «ausgelagert» werden, sie muss ein Kernanliegen der Organisationen werden.
Auf dem Blog des Projekts Art.School.Differences findet sich die Langversion dieses Interviews mit Literaturangaben.
Sophie Vögele ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institute for Art Education an der Zürcher Hochschule der Künste. Sie hat Lehrerfahrung an unterschiedlichen Institutionen im In- und Ausland und schreibt eine Dissertation an der York University in Toronto.
Philippe Saner war wissenschaftlicher Mitarbeiter und Ko-Projektleiter von „Art.School.Differences. Researching Inequalities and Normativites in Higher Art Education“ an der Zürcher Hochschule der Künste (gemeinsam mit Sophie Vögele). Seit 2017 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt „Facing Big Data“ und Doktorand an der Universität Luzern
Der Schlussbericht des Forschungsprojektes „Art.School.Differences. Researching Inequalities and Normativites in the Field of Higher Art Education“ sowie weitere Materialien sind auf dem Blog des Projektes verfügbar: → blog.zhdk.ch/artschooldifferences
Rothmüller, Barbara (2010): BewerberInnen-Befragung am Institut für Bildende Kunst 2009. Wien: Akademie der bildenden Künste. Download unter: → akbild.ac.at
Titelfoto von Igor Miske, Unsplash