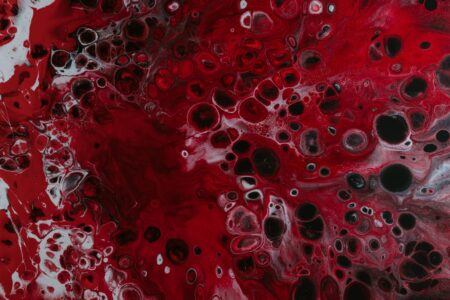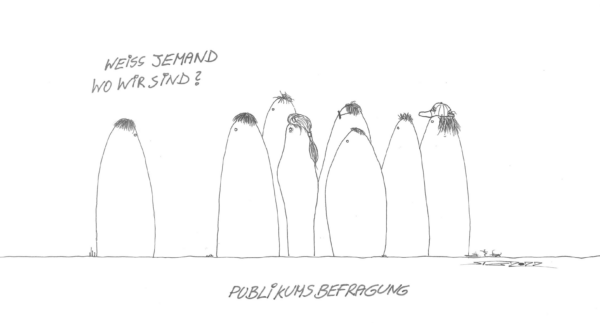Wenn Kunst und Kultur nur noch von weißen, privilegierten Menschen gemacht wird, können wir sie vergessen. Darum muss uns die neue neoliberale Kulturpolitik von Bund und Land große Sorgen machen.
Man lege es mir nicht als Eitelkeit aus, wenn ich bei mir selbst beginne: Der sanfte Spott, ein Rich Kid zu sein, begleitet mich durchs Leben. Lange hat er mich genervt, immerhin kann ich ja nichts dafür, Ärztekind zu sein. Noch dazu, wo die Großeltern noch Kleinstbäuerinnen, Schneider und Wegmacher waren und die Eltern genau wussten, wem sie Aufstieg und Wohlstand verdankten («Ohne die Sozis wär‘ das nicht gegangen!»; was sie übrigens nicht daran hinderte, bis vor kurzem schwarz zu wählen). Spätestens beim Studieren (15 Semester Philosophie) begann ich, Arbeiterkinder ein wenig zu beneiden. Im Hip Hop würde man «street credibility» sagen, im Einführungsproseminar «symbolisches Kapital»; ich fand, dass KollegInnen, die für ihre Bildung kämpfen mussten, irgendwie mehr vom Leben und über die Gesellschaft wissen als ich. Die erste Regel guten Stils ist es nämlich, etwas zu sagen zu haben. (Ich kann Schopenhauer zitieren, danke Bildungsbürgertum!). Mein Wohlstands-Startvorteil verursacht mir seit jeher Misstrauen gegenüber den eigenen Hervorbringungen – leide ich unter first world problems, tragen meine Gedanken Spitzenkragen, schreibe ich reaktionär? Diese autoimmune Skepsis möchte ich mir gar nicht abgewöhnen. Das Privileg, Künstlerin zu werden, musste ich niemandem abringen. Die Entscheidung, mich selbständig zu machen, fiel mir leicht, weil ich in Notlagen auf ein Sicherheitsnetz hoffen durfte. Mein Einkommen sagt zwar, ich sei armutsgefährdet, der Blick aus dem Büro aber zeigt: Garten, Speckgürtel von Linz, zukünftiges Erbe. Ich bin und bleibe ein verwöhntes Ärztekind. Deswegen kann ich es mir leisten, literarisch am Markt vorbei zu produzieren und schlecht bezahlte Essays für Zeitschriften zu schreiben, die mir wichtig sind.
Klar, eine «proletarische» Herkunft adelt noch keinen Roman. Die Söhne von Stahlarbeitern malen nicht automatisch die relevanteren Bilder, Töchter von Rechtsanwälten komponieren nicht per se die fadere Musik. Aber wenn nur noch die Jakobs, Lenas, Emils und Dominikas, die Lehrerkinder und früh geförderten Akademikerinnen Kunst und Kultur machen, ist das im besten Fall einseitig, im schlechtesten ungerecht, saturiert, elitär und irrelevant. Wir alle sollten etwas dagegen haben, dass sich das Bildungsbürgertum künstlerisch reproduziert. Das schadet sowohl der Gesellschaft als auch der Kunst; sie läuft dann Gefahr, bloßer Zeitvertreib, harmlose Behübschung oder gar Propaganda des neoliberalen Zeitgeistes zu werden: «Leistung muss sich auch in der Kunst lohnen! Unser hochbegabter Sohn übt halt auch schon seit dem Kindergarten Violine!» Oder: «Kultur muss sich am Markt behaupten können.» Blödsinn! Kunst zu genießen und Kultur zu schaffen, darf nicht zum Luxus werden. Deswegen müssen KünstlerInnen von ihrer Arbeit leben können – und zwar unabhängig von ihrer Herkunft.
Eine Kulturpolitik, die ihren Namen verdient, muss danach trachten, den Zugang zu Kunst und Kultur zu öffnen, sowohl für Konsumierende als auch für Schaffende. Gegenwärtig plant die neoliberalrechtspopulistische Bundesregierung das Gegenteil, Landeshauptmann Stelzer prescht in Oberösterreich weit voraus. Nicht nur der Freien Szene, die besonders um Diversität bemüht ist, droht der Kahlschlag. Es fehlt nicht mehr viel, dass sich nur noch wir Ärztekinder die prekären Arbeitsbedingungen in Kunst und Kultur leisten können. Das verpflichtet uns Rich Kids zum Protest gegen diese Verhältnisse. Wer tatsächlich glaubt, dass in Zeiten der Hochkonjunktur bei der Literatur mehr als 30 Prozent gespart werden müssen, um ein sinnloses Nulldefizit zu erreichen, hat wohl auch nichts dagegen, dass nur noch Sprücherl-Bücher von Paulo Coelho oder Herrentexte von Thomas Glavinic verlegt werden. Der lässt sich vielleicht sogar einreden, dass freche Literaten wie JosefWinkler oder Michael Köhlmeier das Klima vergiften, weil sie so gegen die Heimatpolitiker hetzen, denen Deutsch eh so wichtig ist.
Wer KünstlerInnen zu Hofnarren und Bittstellerinnen degradiert, schadet dem Land. Wer die Kritik der Kunstschaffenden empörend findet, kann nur davon profitieren, dass bald nur noch jene schimpfen, denen der Papa eh bald das Haus überschreibt.
Photo by Valentina Locatelli on Unsplash