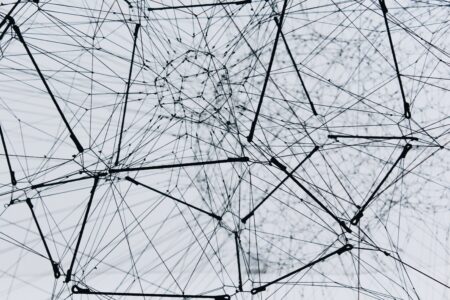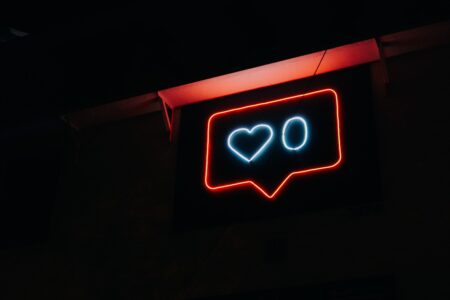Einsparungen und Nulldefizit stehen ganz oben auf der Agenda von Schwarz und Blau in Oberösterreich. Aber muss das wirklich so sein? Müssen „wir“ sparen? Und gibt es Alternativen?

Es klingt ja eigentlich einleuchtend: Wenn die Familie Maier immer mehr Schulden macht, dann bekommt sie irgendwann ein Problem. Sie muss Einsparungen vornehmen. Wenn sie das nicht tut, ist sie irgendwann überschuldet und muss in den (Privat)konkurs. Ähnlich würde es Staaten gehen, daher seien Sparpakete unausweichlich, Nulldefizite erstrebenswert.
Dieser Versuch einer Erklärung hat allerdings einen gewaltigen Haken: Denn ein Staat ist eben keine private Familie. Wenn etwa die Maiers mit ihrem Einkommen eine Wohnung kaufen, dann können sie danach dort wohnen. Weiteren Ertrag wirft die Wohnung nicht ab. Anders bei Staaten: Investitionen in Ausbildung, Forschung oder Infrastruktur sind Investitionen in die Zukunft. Sie machen sich über Generationen bezahlt und schaffen neue Werte.
Nehmen wir als Beispiel die oberösterreichische Schwerindustrie, den zentralen Wirtschaftsmotor des Bundeslandes ob der Enns. Der größte Teil dieser Industrie war einst verstaatlicht, über Jahrzehnte hat der Staat in die Ausbildung der Beschäftigten und in die Infrastruktur investiert. Der Erfolg und die langfristige Wirksamkeit liegen heute auf der Hand. Es gibt allerdings einen zentralen Schönheitsfehler: die Privatisierungswellen ab den 1980er Jahren, durchgeführt zuerst von SPÖ und ÖVP, ab dem Jahr 2000 von ÖVP und FPÖ. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren, nun ernten private AktionärInnen die Früchte der staatlichen Investitionen.
Der Staat ist keine Familie
Private Investoren kennen den Unterschied zwischen dem Staat und den Maiers natürlich genau. Sie legen ihr Geld dementsprechend sehr gern in Staaten an. Die Maiers hingegen könnten eventuell Probleme bekommen, wenn sie einen Kredit brauchen. 2015 legte Österreich sogar erstmals Staatsanleihen auf, die eine negative (!) Gesamtrendite bringen werden. Dennoch war das Papier fast drei Mal überzeichnet. Einem Staat Geld zu borgen ist gerade in unsicheren Zeiten eine sehr gute Kapitalanlage, weil sie sicher ist. Die Aufnahme neuer Kredite ist für hochentwickelte kapitalistische Ökonomien wie Österreich heute sogar ein Geschäft. Die Zinsen sinken bereits seit den 1980er Jahren und können über das Wirtschaftswachstum getilgt werden. Dazu kommt die Inflation, die einen Teil der Schulden auffrisst. Im Endeffekt verdienen Staaten sogar an der Aufnahme von Darlehen.
Immer mehr WirtschaftswissenschafterInnen vertreten sogar die These, dass Staaten heute de facto unbegrenzt Schulden machen könnten. Unter denen, die so denken, sind etwa Larry Summers, der frühere US-Finanzminister, und Olivier Blanchard, ehemals Chefökonom des Internationalen Währungsfonds – beide allzu kapitalismuskritischer Positionen eher unverdächtig.
1.000 Euro? Zu viel für ein Menschenleben

Es gibt allerdings auch Sektoren, wo Investitionen keine Gewinne abwerfen. Das betrifft vor allem den Sozial- und Gesundheitsbereich. Und hier wird es schlicht eine Frage des politischen Standpunkts, wie mit älteren, ärmeren und kranken Menschen umgegangen wird. Ein besonders zynisches Beispiel dafür lieferte einst der Gesundheitsökonom Christian Köck, kurzzeitig auch Vorsitzender des Liberalen Forums, Vorläufer der NEOS.
Im Profil sprach sich Köck im September 2003, also unter Schwarz-Blau I, vehement gegen Vorsorgeuntersuchungen aus. Köcks Begründung laut Profil: «Der jährliche Krebsabstrich bei Frauen ab dem 20. Lebensjahr kostet pro gerettetes Lebensjahr 90.000 Euro. Das Belastungs-EKG für alle 60-jährigen Männer kostet pro gerettetes Lebensjahr 1.000 Euro.» Das wäre schlichtweg zu teuer.
In Oberösterreich sollen nun in jedem Ressort rund zehn Prozent der Ausgaben gekürzt werden, wie Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und weitere Regierungsmitglieder am 23. Oktober laut Standard verkündeten. Allein im Sozialbereich soll die Kürzung in den nächsten vier Jahren 113 Millionen Euro betragen, wie die zuständige Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) erklärte. Betroffen seien unter anderem Menschen mit Behinderungen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie Angebote für Kinder und Jugendliche. Bei der Höhe der angekündigten Summe dürfte das allerdings nur die Spitze des Eisbergs sein.
Zum Vergleich: Allein die zehn reichsten Familien Österreichs besaßen 2016 laut Wirtschaftszeitung Trend rund 78 Milliarden Euro – umgerechnet wären das rund 9.000 Euro für jede/n Bewohner/in Österreichs. Laut einer Studie der Arbeiterkammer besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung rund 40,5 Prozent des gesamten Nettovermögens.
Und wer reich ist, kann durch dubiose Steuerkonstruktionen auch noch Geld sparen. Laut einer Berechnung der SPÖ-Seite «Kontrast» wären die EU-Staaten allein dann bereits in zwölf Jahren schuldenfrei, wenn die reichsten fünf Prozent ihre Steuern in gleichem Ausmaß bezahlen würden wie der Rest der Bevölkerung.
Es ist eine Verteilungsfrage

Stattdessen aber steigt der Reichtum dieser Superreichen seit Jahren kontinuierlich. In der Gesellschaft insgesamt ist somit natürlich genug Geld da, um Sozial- und Gesundheitsausgaben zu finanzieren. Es ist schlichtweg eine Frage der Verteilung. Es gibt dabei kein «Wir», sondern unterschiedliche und gegenläufige Interessen.
Hier positionieren sich neoliberale Parteien eindeutig: Öffentliche Infrastruktur-Aufgaben sollen in der Logik des Marktes zu Leistungen werden, die bezahlt werden müssen. Es ginge «gegen die Gratismentalität», erklärte etwa ein oberösterreichischer Regierungsverhandler gegenüber den OÖN. Das Festhalten am Nulldefizit wird hier zur ideologischen Positionierung.
Doch sogar jene politischen Gruppierungen, die für ein Nulldefizit eintreten, hätten natürlich immer zwei Optionen: Sie können bei Sozial- und Gesundheitsausgaben kürzen oder zusätzliche Einnahmen durch Steuern auf Kapital und Vermögen erzielen. Wofür sie sich dann entscheiden, zeigt, auf welcher Seite sie stehen.