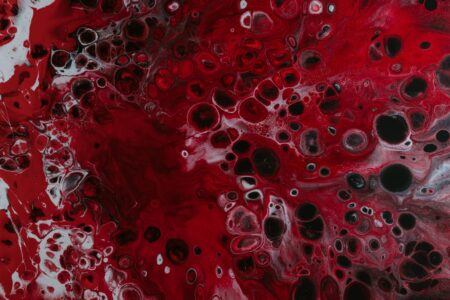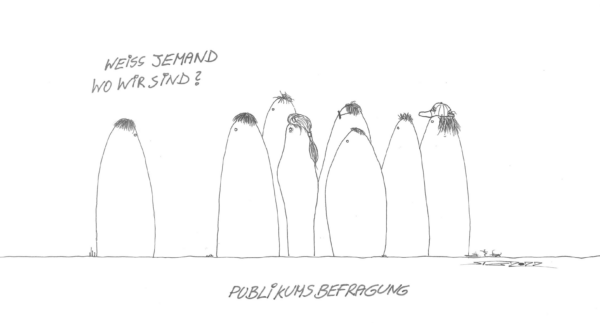Über Kunst als Social Business
Eine Performerin mit einem scheibenförmigen, sie umfassenden Bauchladen steht auf der diesjährigen documenta in Kassel, neben ihr schwarze Seifen, die zu wehrhaft wirkenden Burgen aufgebaut sind. Wo diese schwarzen Seifenstücke nochmal produziert werden, fragt eine Besucherin. In Athen, erwidert die Performerin, die Seifenstücke feilbietet, verkauft und Informationen über die Rohstoffe und den Produktionsprozess gibt.

Carved to Flow heißt der documenta-Beitrag der nigerianischen Künstlerin Otobong Nkanga und er umfasst die Seifenproduktion, die (Verkaufs)Performance und die Installation; der Saaltext bezeichnet die Arbeit zudem als «unternehmerisches Handeln». Die Bedeutung der Rohstoffe und ihrer Ursprungsorte – der Nahe Osten, der Mittelmeerraum und Afrika –, sowie Nachhaltigkeit und Migration sind Themen der Arbeit. Eine Arbeit, die gleichzeitig für sich beansprucht, ein Modell für eine Kreislaufwirtschaft zu sein, indem die Rohstoffe wieder zurück in den Produktionsprozess gelangen bzw. keine (nicht-abbaubaren) Abfälle produziert werden.
Die Papiertonne mit recyclebarem Material zu füllen, ist unser persönlicher Beitrag zum Standardmodell einer Kreislaufwirtschaft – aber deshalb schaffen wir noch lange keine künstlerische Arbeit, wenn wir das Altpapier hinausbringen. Und warum will Kunst denn plötzlich ein Modell für ein Unternehmen, oder wie in manchen Fällen, sogar ein Start-Up sein? Christopher Kulendran Thomas zeigte 2016 etwa bei der neunten BerlinBiennale und der elften Gwangju Biennale – also in den Zentren der Gegenwartskunst – die Arbeit New Eelam, die gleichzeitig ein Start-Up für Wohnungslösungen, die auf geteiltem Eigentum bestehen, und eine Kritik am Konzept von Staatsbürgerschaft ist; der niederländische Künstler Renzo Martens hingegen wurde immer wieder für den Zynismus seiner unternehmerischkünstlerischen Projekte kritisiert.
Von Autonomie zu Ökonomie
Der historische Witz am Interesse der Kunst an Wirtschaft ist die noch für die moderne Kunst proklamierte Autonomie, also ihre Selbstbestimmung bzw. Eigengesetzlichkeit und, wenn man der Kunsttheoretikerin Kerstin Stakemeier folgen will, gerade die Tatsache, dass die Produktion von Kunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mit der damals dominanten Form des Wirtschaftens, dem Fordismus in Form von Fabrikarbeit, zusammenfiel.1 Kunst wurde nicht in der Fabrik hergestellt, sondern in mehr oder weniger traditionellen künstlerischen Medien im Atelier. Dieses Verhältnis zwischen Kunst und Wirtschaft hat sich seit den 1960er Jahren grundlegend gewandelt: Die Konzeptkunst wird oft als Paradebeispiel für das Zusammenfallen von wirtschaftlicher und künstlerischer Produktion genannt – den entstehenden Dienstleistungsgesellschaften entsprechend, zeichnet sich Kunst nun durch etwas Immaterielles aus, ein Konzept. Das Anliegen einer Arbeit wie Carved to Flow ist klar: Sie bezieht ethisch Stellung zu transnationaler Produktion und Handel und sie will ein Social Business sein, also ein Unternehmen, das gesellschaftliche und ökologische Probleme löst, wie von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus entworfen. Aber: Ist das dann noch Kunst oder schlichtweg ein Unternehmen?

Bei Carved to Flow kann man sich nicht aussuchen, ob man die Informationen über die Herkunft der Rohstoffe oder über die Herstellung in Athen, dem zweiten Ausstellungsort der documenta, bezieht: Man muss sie konsumieren. Man muss mit der Künstlerin, zumindest kurz, ihr Interesse daran teilen, dass die wertvollen Rohstoffe, wie die sieben Öle und Buttersorten, aus dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten kommen – allesamt Orte, die wir mit politischen Krisen identifizieren. Wir müssen ihr folgen, weil ohne Hintergrundinformationen die Seife nicht die Besitzerin wechseln wird: ohne Performance kein Verkauf. Otobong Nkanga hat sich entschieden, Ökonomie (altgriechisch οἶκος / oĩkos «Haus» und νόμος / nómos «Gesetz») im Wortsinn ernst zu nehmen: Wenn wir die Füße unter ihren Tisch stellen, bestimmt sie die Regeln. Sie gibt damit aber auch den letzten Versuch einer Autonomisierung, den Versuch, keine Waren zu produzieren, auf – und riskiert, ein Hybrid zwischen Kunst und Wirtschaft zu schaffen.
Superstar
Ein ironischeres Verhältnis zu Wertschöpfungsprozessen im Kunstbetrieb hat die österreichische Künstlerin Veronika Burger. Für ihre Abschlussarbeit an der Akademie der bildenden Künste Wien schuf sie 2013 die Künstlerinnen-Persona SUPER VÉRO, eine Künstlerin mit perfektem CV. Sie gestaltete Ausstellungsposter der fiktiven Künstlerin, für die sie die Logos von großen Institutionen im Kunstbetrieb entwendete; sie schuf ein Artist Fanzine und an unterschiedlichen Orten waren Performancerelikte der nonexistenten Künstlerin zu sehen. SUPER VÉROs (fiktiver) Erfolg ist der Tatsache geschuldet, dass die Figur eine Businessfrau ist, von social ist hier keine Spur. Mit dieser ironischen Überzeichnung und mit der Einschränkung der Reichweite ihrer Kritik auf die Art und Weise, wie Stars im globalen Kunstbetrieb gemacht werden, kann Veronika Burger mit Witz und Präzision ökonomische Fragen und Fragen der Kunstgeschichtsschreibung aufwerfen.

Branding
Beide Beispiele vereint, dass sie einen zentralen unternehmerischen Prozess thematisieren: das Schaffen einer Marke. Bei Carved to Flow erfährt man einiges über die Rohstoffe und ihre Herkunft, die Seife soll durch die Performance mit Bedeutung aufgeladen werden – wie eben auch der Süßwarenhersteller Storck seine Schokoladelinie Merci mit Werten wie Freundschaft und Dankbarkeit durch die allseits bekannten Fernsehwerbungen aufladen will. Gebrochen wird dieser Vorgang einzig durch die Tatsache, dass durch die Zugabe von Kohle die Seife nicht nur schwarz, sondern auch völlig geruchlos ist und zumindest olfaktorisch die Rohstoffe im Endprodukt «stillgelegt» sind. Veronika Burgers Projekt SUPER VÉRO besteht hingegen vor allem in der (ironisch gebrochenen) Schaffung einer Marke und verwehrt sich dagegen, das eigentliche Produkt – die fiktive Künstlerin selbst – als Ware zu produzieren. Die Ware, die Künstlerin ist immer abwesend. Kunst, die gesellschaftlichen Wert beansprucht, will immer die Logik des Kunstfeldes überschreiten und in anderen Feldern relevant sein – und dafür muss sie auch manchmal die Eigengesetzlichkeit dieser Felder anerkennen. Diese Herausforderung stellt sich nicht nur bei den genannten Beispielen an den Schnittmengen von Kunst und Ökonomie, sondern etwa auch bei künstlerischen Projekten, die sozialarbeiterisch tätig werden. Der Unterschied zwischen Kunst und Nicht-Kunst kann nicht alleinig an der Frage liegen, ob eine künstlerische Arbeit auch als Ware funktioniert. Aber sie muss mehr leisten, als nur Gebrauchswert zu sein.