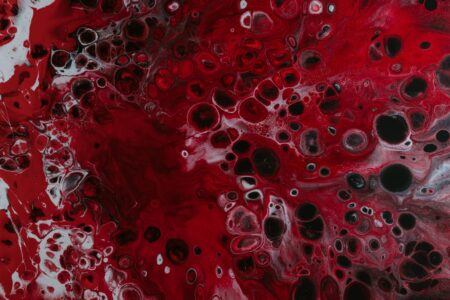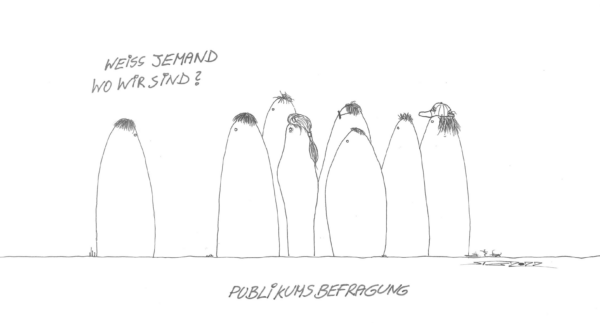Nach Ansicht des Soziologen Oliver Nachtwey hat der Fokus auf Identitätspolitik seit den 1970ern die Verteilungsfrage aus dem Blickfeld der Linken verdrängt. Die Autorin und Aktivistin Barbara Blaha im Gespräch mit KUPF-Vorstand Florian Walter über gesellschaftliche Klassen, die Illusion der Chancengleichheit und Gründe für politischen Optimismus.
Florian Walter: Der Momentum-Kongress widmet sich heuer dem Thema „Vielfalt“. Das klingt im Vergleich zu den Schwerpunkten der Vorjahre (Macht, Kritik) nach Wohlfühlthema. Spielt soziale Ungleichheit keine Rolle mehr?
Barbara Blaha: Gar keine Frage: Soziale Ungleichheit ist das beherrschende Thema unserer Zeit. Die Ungerechtigkeit hat mittlerweile ein Ausmaß erreicht, dass selbst Institutionen wie die OECD oder der französische Arbeitgeberverband MEDEF aufschreien. Als Rezept empfehlen sie ein Ende des ruinösen Wettbewerbs „nach unten“, den vor allem Deutschland betreibt. Mit der Agenda 2010 wurde dort der Sozialstaat massiv heruntergefahren. Man hat immer mehr Menschen in prekäre Jobs gedrängt und die Lohnstückkosten stark gesenkt. Gegenüber Ländern, die ihre Lohn- und Sozialsysteme nicht ruiniert haben, sind deutsche Unternehmen damit im Vorteil. Jetzt empfiehlt Herr Schäuble allen anderen, es doch einfach auch so zu machen.
„Wir sind die reichste, leistungsfähigste Gesellschaft, die es je gegeben hat.“
Aber diese „Empfehlung“ ist der blanke Hohn! Denn das deutsche Modell funktioniert nur, solange die Menschen in anderen Ländern ausreichend Geld besitzen, um deutsche Waren kaufen zu können. Wenn die jetzt dasselbe machen, dann ist der „Exportweltmeister“ ganz schnell am Ende. Das ist die Wahl, vor der wir stehen: Wir können der Wirtschaft erlauben, den Menschen gerade genug Geld zu lassen, um von der Hand in den Mund zu leben. Oder wir können sagen: Wir wollen ein Leben in Würde und Sicherheit für alle. Wir sind die reichste, leistungsfähigste Gesellschaft, die es je gegeben hat. Es ist keine Frage der Möglichkeit, sondern des politischen Willens.
Entstehen durch die wachsende Ungleichheit wieder „Klassen“? Waren diese je verschwunden?
Jahrelang hat man uns weismachen wollen, dass es so etwas wie gesellschaftliche „Klassen“ gar nicht mehr gibt. Wer den Begriff gebraucht hat, war gleich ein „Altlinker“, ein verkappter Bolschewik. Die einzigen, die nie bestritten haben, dass es Klassen gibt, waren interessanterweise die oberen Zehntausend. Der Finanzinvestor Warren Buffett etwa sagt: “Selbstverständlich gibt es einen Klassenkampf. Und es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die dabei ist, ihn zu gewinnen.” Also: Natürlich gibt Klassen. Alle, die zum Fenster rausschauen, wissen das.
Beschäftigte wollen sichere Arbeitsverträge, gute Löhne und eine Pension, von der man leben kann. Unternehmer wollen zwar, dass jemand ihre Sachen kauft, aber sie wollen so wenig Lohn und Sozialabgaben wie möglich zahlen. Hier haben wir es also mit zwei Gruppen zu tun, die gegensätzliche Interessen haben: mit zwei Klassen. Das kann einem gefallen oder nicht, aber wegzudiskutieren ist es nicht.
Der Linken gelingt es derzeit nicht, diese strukturelle Dynamik zu kanalisieren. Fehlt es am Sinn für ein gemeinsames Schicksal, der die Klasse „an sich“ zur Klasse „für sich“ macht?
„Es ist kein Naturgesetz, dass Menschen nach ihren sozialen Interessen handeln.“
Es ist kein Naturgesetz, dass Menschen nach ihren sozialen Interessen handeln. Vor allem werden sie nur dann aktiv, wenn Sie den Eindruck haben, auch etwas bewirken zu können. Das ist offensichtlich bei weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr der Fall. Diese Menschen haben sich aus dem politischen Prozess verabschiedet, weil sie – nicht ganz zu Unrecht – das Gefühl haben, dass die Politik keine Rücksicht auf sie nimmt. Die Politik ihrerseits verschanzt sich hinter den berühmten „Sachzwängen“: Wir können nicht anders, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Was übrig bleibt ist Frustration und Angst. Beides mündet in einem gewaltigen Zorn, und mit diesem hantieren dann Rechtsparteien. Die machen sich wirtschaftspolitisch für die Reichen stark. Zugleich reden sie den Leuten ein, das Problem sei nicht ihr niedriges Einkommen und die hohe Miete, sondern der türkische Nachbar mit noch niedrigerem Einkommen, der davon eine noch höhere Miete zahlen muss.
Hat das Streben nach Chancengleichheit den Kampf gegen Ausbeutung verdrängt?
Der Begriff Chancengleichheit, den Blair, Schröder und auch Gusenbauer so gerne benützt haben, ist eine perfide Täuschung. Er akzeptiert das Prinzip „jeder gegen jeden“ und tut so, als bestünde Gerechtigkeit nur darin, gleiche Spielregeln für alle herzustellen. Wer dann scheitert, hat seine Chance gehabt – selber Schuld wenn es nicht geklappt hat. Wäre er oder sie nur etwas fitter und motivierter gewesen, könne man jetzt auch am Pool sitzen, Cocktails schlürfen und andere für sich arbeiten lassen. Was für eine Lüge.
„Chancengleichheit gibt es nicht, solange Besitz vererbt wird.“
Chancengleichheit gibt es nicht, solange Besitz vererbt wird. Der entscheidende Moment für das Erwerbsleben ist nicht das Talent, die Intelligenz, die Ausbildung und oder gar der Charakter eines Menschen. Der wichtigste Moment ist die Geburt: Werde ich in eine reiche oder in eine arme Familie hineingeboren? Das Gerede von der Chancengleichheit lenkt gezielt von den realen Verhältnissen ab.
Vom Rechtspopulismus wird der Klassenkampf diskursiv zum Kulturkampf umstilisiert. Fehlt der Linken ein solches gemeinsames Narrativ?
Wir brauchen nichts umstilisieren. Das ist ja der große Vorteil der Linken: sagen zu können, was ist – und Forderungen aufzustellen, die der Mehrheit der Menschen nützen. Man stelle sich vor: Jedes Kind in Österreich erhält die optimale Bildung; jeder pflegebedürftige Mensch hat eine gut ausgebildete, fair bezahlte Fachkraft, die sich um ihn kümmert; für alle steht leistbarer, hochwertiger Wohnraum zur Verfügung; alle haben statt fünf sieben Wochen im Jahr Urlaub; ältere Arbeitnehmende warten nicht in der Langzeitarbeitslosigkeit auf die Frühpension, sondern haben mit sechzig eine ordentliche Pension und noch ein paar gute Jahre ohne Sorgen vor sich; und weil die Alten ihnen nicht die Arbeitsplätze versitzen, haben die Jungen nicht jahrelang prekäre Verträge, sondern eine geregelte Arbeit und ein ordentliches Einkommen. All das sind keine linken Fieberphantasien.
„Es wird deutlich, dass es eine enorme Sehnsucht nach einer Änderung zum Besseren gibt.“
Wenn wir uns die Kampagne von Bernie Sanders in den USA oder von Jeremy Corbyn in Großbritannien ansehen, wird deutlich, dass es eine enorme Sehnsucht nach einer Änderung zum Besseren gibt. Nach einer politischen Agenda, die das Leben für alle besser macht, nicht nur für das oberste Prozent. Wenn jemand glaubwürdig diese Sehnsucht vertritt, mache ich mir um den Zuspruch keine Sorgen.
In welchem Bereich siehst du die Zukunft einer solidarischen und demokratischen Gesellschaft?
Buchstäblich überall, wo Menschen sich zusammentun, gibt es Hoffnung. Das können Parteien und Gewerkschaften sein, aber auch andere Formen von Organisationen. Wenn viele Menschen sich zusammenschließen und ihre Ziele gemeinsam verfolgen sind sie nur sehr schwer aufzuhalten. Die „Großen“ haben unermesslich viel Geld. Die „Kleinen“ sind aber immer in der Mehrzahl. Sie dürfen sich nur nicht auseinander dividieren lassen.
Wo stehen wir in 15 Jahren? Ist Optimismus oder Pessimismus angebracht?
Ich verdiene mein Geld nicht mit dem Deuten von Kristallkugeln. Fest steht nur: Es wird von uns abhängen. Das ist es, was mich optimistisch macht.
Eine Empfehlung zu Oliver Nachtweys aktuellem Buch „Die Abstiegsgesellschaft“ gibt es hier.