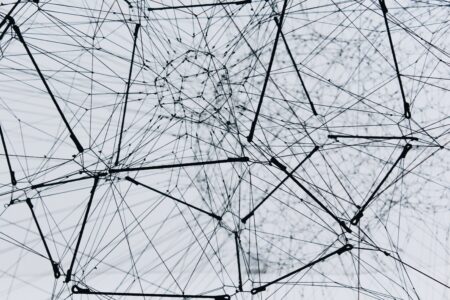Martin Fritz über private und staatliche Finanzierung von Kunst und Kultur in den USA. Er räumt mit der These auf, dass in den USA ausschließlich privat finanziert werde und unterstreicht dies mit drei konkreten Beispielen, bei denen die öffentliche Hand eine Rolle spielt.
Zu den ewig grüßenden Murmeltieren des Diskurszoos gehört die Frage nach dem Verhältnis des Kunstsektors zum privaten Kapital, und die damit verbundene Anschlussfrage nach dem Vorbildcharakter des «privat finanzierten» US-Kunstsystems. Von den Privatisierungsfreund_innen werden dann die altbekannten Stereotypen aufgewärmt, wie die angebliche Abwesenheit eines regulierenden Marktes, die dafür verantwortlich wäre, dass sich das europäische, subventionierte Kunstsystem zu einer tabuisierten Schutzzone untereinander verklüngelter – und ansonsten eigentlich bedrohter – Arten entwickelt hätte. Diese Argumentation übersieht geflissentlich, dass ein öffentlich ausgetragener Wettbewerb geförderter Institutionen, in Verbindung mit einem beobachtbaren Kunstmarkt, einer immer noch existierenden Kunstkritik und einer aktiven Kulturpolitik auch als Muster für jene angeblich selbstregulierungsfähigen Systeme verstanden werden könnte, als die sich «die Märkte» gerne selber stilisieren, bevor sie z.B. wieder daran gehen, in den Hinterzimmern einen Leitzinssatz zu manipulieren oder staatliche Unterstützung einzufordern.
Doch auch die Argumentation der europäischen Etatist_ innen, die sich gerne auf «schwierige, spröde und kritische» Kunst bezieht, die ohne öffentliche Förderung nicht möglich wäre, beinhaltet Elemente von Selbstbetrug, wenn etwa bedacht wird, dass die höchste Einzelförderung am Wiener Kunstplatz, mit 58,7 Millionen Euro, der Wiener Staatsoper zu Gute kommt, von deren spröder und kritischer Praxis wir noch nicht allzu viel hören konnten. Hier – wie auch bei den Salzburger Festspielen – könnte einmal das Gedankenexperiment angestellt werden, ob diese Angebote denn für ihr kaufkräftiges Zielpublikum nicht mittlerweile zu billig sind, wenn etwa der Genuss einer Wiener Eliteopernproduktion aus der ersten Reihe Parkett nur knapp über 200 Euro kostet, was etwa im Vergleich zu den Übernachtungs- und Verpflegungskosten in den benachbarten Nobelhotels nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Eine vergleichbare Karte an der New Yorker Met käme auf einen Preis von ca. 350 Euro.
Der Textsprung über den Atlantik dient dazu, zum gefühlten 1000sten Mal zu erklären, dass die Schimäre eines zu 100 % privat finanzierten US-amerikanischen Kunstsystems nur als Fabeltier im neoliberalen Argumentesumpf herumspukt. Wenige, leicht recherchierbare Beispiele zeigen, dass die öffentliche Hand auch in den USA eine Rolle im System der Kunstfinanzierung spielt. Ermattet von der x-ten Wiederholung dieses Umstandes beschränken wir uns hier auf drei Beispiele:
1) Entgegen landläufiger Meinung kennen auch die USA «Bundesmuseen». Den Proponent_innen eines privat finanzierten Museumsbetriebes «nach US-Vorbild» sei vermittelt, dass sich die größte Museumsinstitution der Welt in Washington D.C. und in direkter Staatsverantwortung befindet. Die stolzen 19 Museen und Institute der Smithsonian Institution, vom Hirshhorn Museum and Sculpture Garden bis zum National Air and Space Museum, beschäftigen dabei mehrere Tausend öffentliche Beamte und wurden im letzten Budget der Obama Administration mit knapp unter 800 Millionen Dollar bedacht. Nicht zuletzt deswegen sind sie grundsätzlich bei freiem Eintritt zu besuchen. Die Institution leitet übrigens ein 17-köpfiges «Board of Regents» in dem der jeweilige Chief Justice ebenso vertreten ist, wie 7 gewählte Politiker_innen, darunter der Vizepräsident der USA, und 9 Bürger_innen, die somit die Mehrheit bilden könnten.
2) Auch in New York, im Mekka des Privatkapitals, existiert ein Sockel von öffentlicher Kunst- und Kulturfinanzierung und es ist ärgerlich, wenn dieser Umstand auch von Kulturpolitikexpert_innen in den vielen Erzählungen vonspendenfreudigen Milliardär_innen nicht erwähnt wird. Dabei genügte ein Blick auf die Liste jener 33 Organisationen, die in der Cultural Institutions Group (CIG) der Stadt New York zusammengefasst sind, um zu erkennen, dass die Stadt New York auch aus der eigenen Tasche zum dichten Kulturleben der Stadt beiträgt. Vom geförderten American Museum of Natural History oder dem Museum of the City of New York bis hin zum P.S.1 (in einem Gebäude der Stadt New York), dem Studio Museum in Harlem und dem Bronx Zoo reicht die Liste derer, die die Kulturabteilung der Stadt sogar als «City-owned» bezeichnet. Natürlich liegt die Summe laufender Betriebsförderungen mit insgesamt 155,6 Millionen Dollar im Jahr 2013 unter den Wiener Ansätzen, doch der zusätzlich bekanntgegebene Wert von 632 Millionen Dollar für Investitionen der nächsten vier Jahre verschafft ein gutes Argument dafür, dass es im Schatten von Wall Street eben auch öffentliche Investments sind, die für die berühmte Dichte und Diversität des städtischen Kulturlebens verantwortlich sind.
3) Auch Künstler_innen und Ausstellungsräume leben in den USA nicht nur «vom Markt». Zahlreiche staatliche, bundesstaatliche und kommunale Stellen agieren in den USA als Förderinstanzen für Einzelkünstler_innen und ihre Projekte, wobei jedoch manchmal nur die ausstellenden Organisationen als Antragsteller_innen zugelassen werden. So beim New York State Council of the Arts, das für 2012 Förderungen von knapp über 2 Millionen Dollar unter dem Titel «Individual Artists» ausweist, während das National Endowment for the Arts im Jahr 2011, über alle Sparten hinweg, immerhin 70 Millionen Dollar für Programme unter dem Titel «Acess to Artistic Excellence» zur Verfügung stellte.
Gewiss: Die Summen sind für ein riesiges Land oft gering und der Kapitaleinsatz so mancher privater Philantrop_innen überlagert hin und wieder spektakulär die öffentlichen Beiträge. Doch sogar noch ohne Berücksichtigung der Steuerverluste, die der amerikanische Fiskus durch die steuerliche Absetzbarkeit in Kauf nimmt, und ohne eine Bewertung der Anreizwirkung öffentlicher Beteiligung für privates Engagement lag im Jahr 2008, laut einer Studie der Kennedy School of Government, der durchschnittliche Anteil öffentlicher Förderung im US-Museumssektor bei 27,9 %. Dies wäre zwar auch kein Grund das dortige System als Vorbild zu nehmen, doch es muss immer wieder dazugesagt werden, wenn mit unzureichender Information so getan wird, als gäbe es weiter westlich eine Alternative ganz ohne Staat.
→ martinfritz.info
→ artmagazine.cc
Dieser Artikel wurde erstmals 2013 im artmagazine publiziert und für die KUPFzeitung überarbeitet.