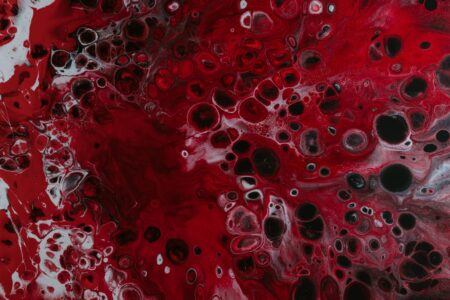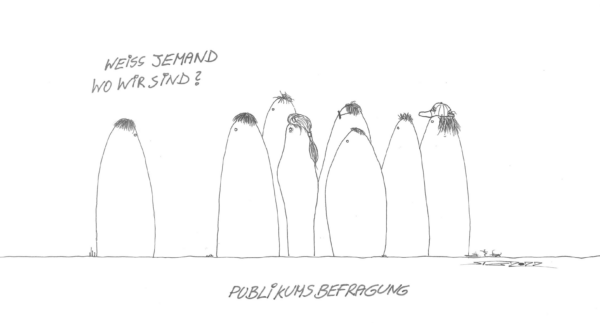In den oberösterreichischen Landesmuseen kämpfen knapp zwei Dutzend Kulturvermittlerinnen gegen ihre prekäre Beschäftigungssituation. Doch während andere Bundesländer bereits Lösungen gefunden haben, scheint die Politik in Oberösterreich auf Zeit zu spielen.
„So wie ich arbeite, müsste ich eigentlich fest angestellt werden.“ Das dachten zuerst wenige und dann viele. Bis zu 20 Jahre sind sie schon dabei, zum Teil alleinerziehende Mütter, die hochprofessionell arbeiten und in der Landesgalerie, im Schlossmuseum oder im Biologiezentrum ihren Lebensunterhalt verdienen. Und doch gehören sie nicht wirklich dazu, denn eines unterscheidet sie von ihren Kolleginnen: Sie sind prekär beschäftigt, laufen im Budget unter Sachaufwand und arbeiten auf Werkvertragsbasis, einige wenige auch als freie Dienstnehmerinnen. So angenehm das für Studentinnen sein mag, so problematisch ist es auf Dauer. Denn Prekäre müssen auf viele arbeitsrechtliche Errungenschaften verzichten, vom Weihnachtsgeld und bezahlten Krankenstand bis hin zum Urlaubsanspruch. Und sich natürlich selbst versichern. Eine „Flexibilität“, die im neoliberalen Zeitalter neben der Wirtschaft zunehmend auch von der öffentlichen Hand geschätzt wird.
Akademikerinnen erwünscht
Von Prekarisierung betroffen sind vor allem neue Berufe, die durch gesellschaftlichen Wandel oder wachsende Professionalisierung erst entstanden sind. So wie die Kunstvermittlerinnen der OÖ Landesmuseen. Früher machten den Job meist junge Leute neben dem Studium und die Fluktuation war dementsprechend groß. In den letzten Jahren hat sich aber ein fixes Team etabliert, unter ihnen Historikerinnen, Biologinnen und andere Akademikerinnen. Qualifikationen, die man auch im Anforderungsprofil der Landesmuseen als „erwünscht“ finden kann. Aus dem klassischen „Studentinnenjob“ ist also ein qualifizierter Beruf mit umfassenden Aufgabenfeldern geworden. Heute sind die Kunstvermittlerinnen neben den Führungen auch bei Workshops, in der Projektarbeit und im Organisationsteam tätig. Sie schreiben Vermittlungskonzepte und organisieren Veranstaltungen. Allein, definiert hat diesen Beruf noch niemand.
Aus Einzelkämpferinnen wird ein Team
Prekär zu sein bedeutet in der Regel auch Einzelkämpferin zu sein. Manche gingen davon aus, irgendwann eingestellt zu werden, wenn sie nur lange genug dabei sein und gute Arbeit leisten würden. Spätestens nach Linz09 war aber klar, dass es von alleine nicht dazu kommen würde. In anderen Bundesländern war man schon weiter. Durch Selbstorganisierung und anhaltende Kritik der Gebietskrankenkasse konnten bereits erfolgreiche Abschlüsse verhandelt werden. In Linz wurde eine Tagung des Verbandes der Kulturvermittler zum Schlüsselerlebnis, denn dort hörten die Kunstvermittlerinnen von den Erfolgen anderswo. Sie besuchten daraufhin andere Museen, trafen Kolleginnen und begannen sich ebenfalls zu organisieren: „Wir haben gesehen, dass Veränderungen möglich sind und waren bereit etwas zu tun.“ Ein regelmäßiger Stammtisch ist seitdem Dreh- und Angelpunkt der Aktivitäten und plötzlich war es nicht mehr so einfach, die vormaligen Einzelkämpferinnen gegeneinander auszuspielen – bisher gängige Praxis im Umgang mit Prekären. Es folgten Monate des Klinkenputzens und Laufens. Die wichtigste Aufgabe war es aber, die gewählten Sprecherinnen der Gruppe als Verhandlungspartnerinnen zu etablieren. Mit Hartnäckigkeit haben sie zumindest das geschafft. Doch zahlreiche Termine bei ÖGB, AK und dem Land brachten außer Verständnisbekundungen bislang keinen Fortschritt. Da hilft es auch nichts, dass Chefetage und Kolleginnen im eigenen Haus überwiegend solidarisch sind. Denn zuständig ist das Personalressort des Landes und dort machte man schnell klar, dass fixe Anstellungen definitiv nicht infrage kommen.
Schuld ist eine Ideologie
Der Landeshauptmann versicherte aber zumindest an einer guten Lösung interessiert zu sein. Konkret heißt das vor allem eines: warten. Eine Entscheidung wurde eigentlich bereits bis Ende vergangenen Jahres versprochen. Doch warum ist es so schwierig, eine Handvoll Kunstvermittlerinnen fix anzustellen? Der Grund ist ein ideologischer: Neuanstellungen sind prinzipiell tabu und deshalb muss Sachaufwand weiter Sachaufwand bleiben. Das Land fürchtet offenbar einen Präzedenzfall, der auch in anderen Bereichen „Begehrlichkeiten“ wecken könnte. Trotzdem gibt es aber schon erste Erfolge, denn die im Prinzip solidarische Museumsleitung hat den Stundensatz deutlich angehoben. Der Sachaufwand ist also zumindest schon teurer geworden.