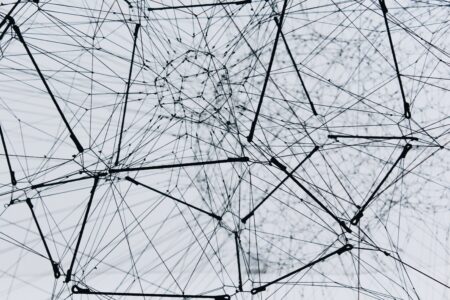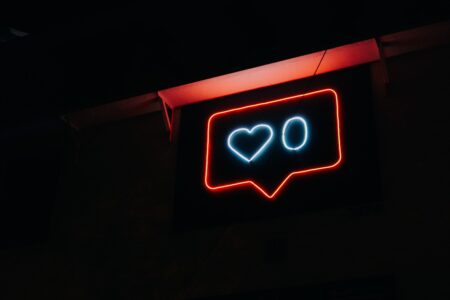Juliane Alton über das ideologische Gebäude des Grundeinkommens.
Das ideologische Gebäude des Grundeinkommens versteht Arbeit als Strafe und setzt Gemeinsinn als Ziel.
Arbeit ist die Strafe für den Sündenfall. Gott hat sie Adam auferlegt: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen“, während Eva „mit Schmerzen Kinder gebären“ muss – fragt sich, wer es schlimmer getroffen hat, da doch schweißtreibende Arbeit immer auch zum Alltag der Frauen gehörte. Offenbar hat Gott nicht mit der Entwicklung von Finanzsystemen gerechnet, die dazu führen, dass schon längst Lohn und Leistung, Geld und Arbeit entkoppelt sind und Kapitalbesitzer / innen – obschon nicht sündenfrei – so doch nach Wunsch frei von Erwerbsarbeit leben können und der Strafe entgehen. Der historische Prozess der Zivilisation ist geprägt von Erfindungen, die andere Energien als die Muskelkraft in Dienst nehmen und den Schweiß durch Intelligenz und Rohstoff ersetzen. Die private Akkumulation jedoch führt dazu, dass weder Arbeit noch Armut verschwunden sind. Es kann also nach wie vor als Ziel gelten, dass nur noch „freiwillig“ gearbeitet wird und niemand sich als Lohnsklave/- sklavin fühlen muss. Dies verspricht das Grundeinkommen – im Gegensatz zur Grundsicherung.
Die bedarfsabhängige Grundsicherung ist nichts weiter als ein funktionierendes soziales Netz, das – wenn alle (Arbeits-) Stricke reißen – das physische Überleben einer Person mit Wohnraum und den materiellen Grundbedürfnissen sichert. Es entspricht ideologisch der Sozialhilfe und greift erst, wenn jemand nicht arbeitsfähig ist bzw. keine bezahlte Arbeit finden kann, sein Vermögen veräußert hat und keine Verwandten in die Pflicht genommen werden können. Die Bedarfsabhängigkeit bringt die soziale Stigmatisierung ins System. Ständige Überprüfungen und Nötigung zur Erwerbsarbeit ersetzen die „Arbeitsqual“.
Das bedingungslose Grundeinkommen hingegen ist ideologisch gesehen die Befreiung vom Zwang zur Erwerbsarbeit. Es richtet sich weder gegen Arbeit an sich noch gegen hohe Einkünfte. Es zielt nur darauf ab, den Menschen die Wahl zu lassen zwischen „Faulenzen“, Erwerbsarbeit (Leistung für Geld) und „ehrenamtlicher“ Arbeit (oder einer Kombination daraus). Arbeit würde ihren Strafcharakter verlieren, Ausgrenzung aufgrund von Arbeitslosigkeit abgemildert. Über die Höhe und die Art der Finanzierung des Grundeinkommens muss noch und wird auch vielerorts nachgedacht werden. Schon im antiken Stadtstaat gab es die Vision, dass die Bürger sich edleren Dingen als der Güterproduktion widmen: der Entwicklung des Gemeinwesens (Politik) und der Kunst – die schweißtreibende Arbeit blieb Sklaven/ Sklavinnen, Frauen und Ausländer/innen überlassen.
Keine politische Partei in Österreich tritt für das Grundeinkommen ein, das käme tatsächlich einer Revolution gleich, da die herrschende Wirtschaftsund Gesellschaftsform die Würde des Menschen mit Geld und Erwerb verbindet. Für die Grundsicherung hingegen gibt es einige Modelle: Die KPÖ hat 2001 ein von Heidi Ambrosch ausgedachtes Grundsicherungsmodell vorgestellt. Es knüpft an die Erwerbsarbeit an, die generell auf 32 Stunden verkürzt werden soll, Mindestlohn inklusive. Finanziert würde dies über nationale und internationale Umbauten des Steuersystems. Auch die SPÖ fordert eine bedarfsorientierte Grundsicherung (Konzept des „Netzwerks Innovation“ von 2001). Gedacht ist an eine bundeseinheitliche Sozialhilfe, deren Höhe sich am Ausgleichszulagenrichtsatz orientiert und als Rechtsanspruch ausgeformt wird. Die Kosten dafür werden mit rund 218 Mio. Euro beziffert.
Die Grünen haben bereits Mitte der 90er Jahre ein Grundsicherungssystem gefordert, das Lücken im bestehenden Sozialsystem schließen und 60% des Medianeinkommens der Arbeitenden (ca. 834 Euro) pro Mensch betragen soll. Dies sei, mit gerechtigkeitsorientierten Umschichtungen im System, fast aufkommensneutral. Neu ist das Projekt der Grünen zur Grundsicherung von Künstler/innen: Kultursprecher Wolfgang Zinggl hat ein Konzept vorgestellt, nach dem jene Einkommen von Künstler/innen staatlicherseits aufgestockt werden, die 900 Euro im Monat nicht erreichen. Abzüglich der Sozialversicherungsbeiträge von ca. 25% blieben davon ca. 680 Euro in den Taschen der Künstler/innen. Nach Zinggls Berechnungen kostet dies etwa 23,1 Mio. Euro, die aus folgenden Quellen aufgebracht werden sollen: Ersparnis derzeitiger Sozialleistungen (z.B. Notstandshilfe), Einnahmen und Rücklagen des Künstlersozialversicherungsfonds, der sich erübrigen würde, SKE-Mittel der Verwertungsgesellschaften, und aus Kunstförderungsgeldern soll zusätzlich eine Rücklage gebildet werden.
Spannend erscheint die „Initiative€2000“, eine wahlwerbende Gruppe, die Müttern (Erziehungsberechtigten) 2.000 Euro pro Monat geben will (minus 10% Einkommensteuer, 10% Krankenversicherung und 20% Pensionsversicherung sind das 1.200 netto), dies von Mitte der (ersten) Schwangerschaft bis zum 18. Geburtstag des (jüngsten) Kindes. Kinder bekommen 1.000 Euro abzüglich der selben Beitragssätze, Studierende können sieben Jahre lang ein Darlehen zwischen 1.000 und 2.000 Euro (dieselben Abzüge) erhalten, 60% davon sind wertgesichert innerhalb von 21 Jahren zurück zu zahlen. Die Kosten für dieses eingeschränkte Grundeinkommensmodell sind mit 30 Mrd. Euro im Jahr angegeben, die nach Berechnung der Initiative zeitversetzt wieder hereinkommen. Diese Rechnung ist für die Verfasserin nicht unmittelbar nachvollziehbar, sie erscheint aber auch nicht völlig abwegig.
Das KPÖ-Modell fordert Vollbeschäftigung und Normalarbeitsverhältnisse, ist also ideologisch rückwärts orientiert, auch in Bezug auf das Selbstverständnis vieler Arbeitender, z.B. jenem der „freien“ Künstler/innen und Kulturarbeiter/innen, die sich nicht mehr in genormte Arbeitsverhältnisse pressen lassen wollen. Das Modell hat keine Antwort auf die bereits erfolgte Entkoppelung von Geld und Leistung. Das SPÖ-Modell entspricht einer Reform der derzeitigen Sozialhilfe und wäre in diesem Sinn zu begrüßen, ist doch die Sozialhilfe derzeit in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Es ist aber qualitativ nichts Neues und findet seine Grenze an der ideologischen Haltung der ausführenden Beamt/innen, die – mit oder ohne Rechtsanspruch – das Ansuchen um Sozialhilfe zu einer besonders erniedrigenden und mühsamen Arbeit machen können.
Das Modell der Grünen hat nur in einem Punkt (zwei Jahre bezahlte Karenz für jeden Menschen) einen kleinen Zug Richtung Grundeinkommen und ist im Übrigen erwerbs- und bedarfsorientiert. Das gilt auch für das Künstler-Modell: es würde zwar die erniedrigenden und bürokratischen Nachweisprozeduren weit gehend überflüssig machen, sobald jemand als Künstler/in „anerkannt“ ist. Die Finanzierung über das derzeitige Aufkommen des Fonds (Kabelbetreiber und Sat-Importeure) und SKE sieht die Autorin kritisch. Zum einen ist nicht einzusehen, warum nur eine bestimmte Gruppe von Verwertern zur Finanzierung herangezogen wird. Zum anderen „gehört“ das SKE-Aufkommen bereits den Künstler/innen, allerdings soll die Art der Verwendung durchaus hinterfragt werden. Kein großer Wurf.
Einzig das Modell der Initiative€2000 setzt einen wirklichen politischen Akzent, ohne im Pragmatismus stecken zu bleiben. Es setzt bedingungslos auf bestimmte Leistungen wie Erziehungsarbeit und Studieren und würde das Wertgefüge der Gesellschaft dadurch nachhaltig beeinflussen, ohne das System als solches gleich aus den Angeln heben zu wollen. Es könnte somit als Schuhlöffel für ein allgemeines Grundeinkommen fungieren. Denn bleibt es bei Erziehenden, Kindern und Studierenden, besteht die Gefahr, dass Frauen weiterhin aus dem lukrativeren Teil des Arbeitsmarktes ausgeschlossen bleiben.
Literatur: Wolfgang Engler: Bürger ohne Arbeit. Berlin 2005.
Juliane Alton ist Kulturarbeiterin und Obfrau der IG Kultur Österreich.