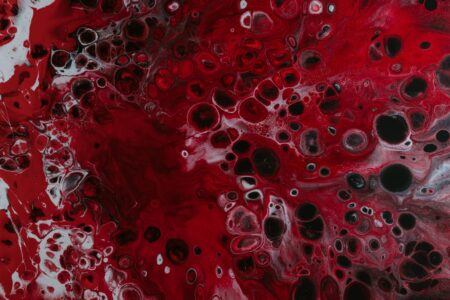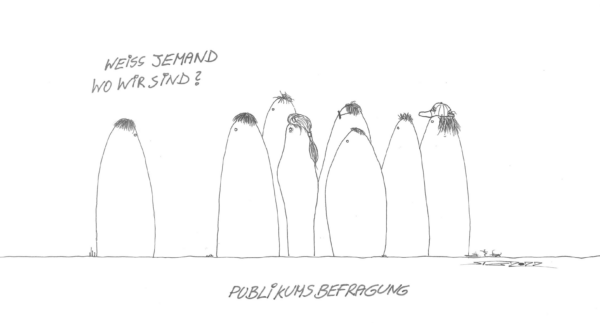Katharina Serles hat mit dem erfahrenen Juror und Beirat Thomas Philipp über Tipps und Tricks für Antragstellungen und den Umgang mit den alles entscheidenden Gremien gesprochen.
Katharina Serles: Wie kommt man überhaupt in Jurys oder Beiräte und wie setzen sich diese zusammen?
Thomas Philipp: Ausschreibende Stellen besetzen Gremien nach mehr oder weniger definierten Kriterien. Beim Kulturinitiativenbeirat gibt es beispielsweise Vorschlagsempfehlungen von Dachverbänden und Interessenvertretungen. Bei den Kriterien geht es zumeist um fachliche Kompetenz und Polyvalenz. Das heißt, dass Personen Expertise in mehreren Bereichen haben, um Einreichungen aus verschiedensten künstlerischen Sparten beurteilen zu können.
Wird in Jury-Zusammensetzungen bereits auf Diversität geachtet?
Immer, eigentlich. Denn es geht ja nicht nur um verschiedene Zugänge, was künstlerische Sparten betrifft, sondern auch um kulturelle Zugänge, Geschlechterparitäten und die Abbildung von gesellschaftlicher Vielfalt.
Wie funktioniert denn die Entscheidungsfindung in Jurys? Wer setzt sich durch?
Das variiert klarerweise total von Gremium zu Gremium, auch abhängig von den Vorgaben der ausschreibenden Stelle. Oftmals ist es so, dass Jury-Mitgliedern sehr viel freie Hand gegeben wird, um nicht zu stark einzugreifen. Gerade wenn es um künstlerische Produktionen geht, dominieren meist Qualitätskriterien über formale. Normalerweise gibt es aber eine Person, die moderiert und dafür sorgt, dass alle Jury-Mitglieder zu Wort kommen.
Werden Jury-Tätigkeiten (von Zusammensetzung bis zur Entscheidungsfindung) üblicherweise evaluiert?
Das wäre wünschenswert, passiert aber nicht immer. Jurys kommen ja meistens nur punktuell zusammen. Wichtig sind jedenfalls Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Öffentliche Jury-Sitzungen wie beim KUPF Innovationstopf oder den TKI open finde ich eine Möglichkeit, dies zu gewährleisten.
Das zentralste Element im Förderprozess ist wohl der Antrag. Was sind deine persönlichen TOP 3 Kriterien, wenn du einen Antrag bewertest?
Kriterium Numero 0 betrifft die Vorgaben der ausschreibenden Stelle. An die halte ich mich natürlich; sie stechen jegliches subjektive Kriterium. Numero 1 ist dann die inhaltliche Qualität des Antrags: Inwieweit ist die Idee zeitgemäß? Ist das etwas Neues? Schließt das an gegenwärtige Diskurse an? Ist es zukunftsfähig oder nachhaltig und wird etwas dadurch ausgelöst? Numero 2: Wieviel ‚Impact‘, wieviel Wirkung hat diese Einreichung auf die Region, das Umfeld, die künstlerische Sparte oder den kulturellen Bereich? Wird darauf geschaut, dass auch auf nicht diskriminierende Effekte gesetzt wird? Das ist auch quantifizierbar: Wird die Produktion nur für einen sehr eingegrenzten, fast elitären, Bereich vermittelt? Werden die entsprechenden Zielgruppen angesprochen? Mein Kriterium Numero 3 bezieht sich auf die formalen Kriterien.
Bleiben wir kurz bei quantifizierbaren Kriterien: Welche gibt es noch?
Ein Kriterium betrifft oft das Budget: Man hat z. B. einen Antrag, der zwar eigentlich ganz gut ist, der aber so viele Ressourcen brauchen würde, dass das gesamte Förderprogramm damit ausgeschöpft wäre. Oder die Kalkulation ist nicht stimmig – zu hoch oder auch zu niedrig. Es ist nicht gut, wenn man als Juror_in feststellen muss, dass beteiligte Künstler_innen sehr schlecht oder überhaupt nicht bezahlt werden.
Kann man die Kriterien einer Jury als Antragsteller_in auch antizipieren?
Definitiv! Jury-Zusammensetzungen selbst werden nicht immer veröffentlicht, aber es hilft schon, die Jurys der letzten Jahre zu recherchieren, um eine Vorstellung zu bekommen. Beiratsmitglieder oder etwa Jurys von Sonderförderungsprogrammen der Stadt Linz werden jedenfalls veröffentlicht; diese kann man über die Website oder einen Anruf herausfinden. Die Einreichkriterien werden immer bekannt gegeben. Da lautet die Devise: Keine Einreichung ohne Berücksichtigung der Kriterien. Das ist zwar oft kein Knockout-Kriterium, aber es löst immer Diskussionen aus. Man sollte sich also wirklich daran halten. Das ist ein Zeichen von Professionalität.
Kommen wir zu den formalen Kriterien: Wie spricht man über das eigene Projekt, welcher sprachliche Duktus ist adäquat für einen Antrag?
Ich würde sagen ein fachspezifischer Duktus. Man erwartet, dass die Antragsteller_innen wissen, wovon sie sprechen, dass sie zeigen, dass sie das Feld kennen. Das funktioniert etwa über gewisse ‚Buzzwords‘. Wenn es zum Beispiel um Kulturarbeit geht, erwartet man als Jury Schlagworte wie ‚Teilhabe‘‚ ‚Inklusion‘, ‚Partizipation‘ usw. Ein zweites Beispiel zum Thema sprachliche Korrektheit: Immer wieder werden Künstler_innen falsch geschrieben. Bestenfalls ist das Schlampigkeit, aber im schlechtesten Fall ist das Respektlosigkeit oder Ignoranz. Jedenfalls sind dann Defizite da, die in der Jury diskutiert werden. Grundsätzlich würde ich sagen: am besten eine klare, nachvollziehbare Sprache wählen. Nicht vollkommen abgehoben, das bringt fast nie etwas. Jurys und Beirät_innen hassen es, wenn eine Einreichung acht Seiten umfassen soll und dann kommen 40 Seiten philosophische Abhandlung.
Wie sieht es mit Gendern aus? Wird das deiner Erfahrung nach honoriert?
Selten ist es ein Ausschlusskriterium. Der überwiegende Teil der Beirats- oder Jury-Mitglieder, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ist dem Gendern aber durchaus positiv eingestellt.
Und inhaltlich/strukturell – sollten Projektanträge geschlechterparitätisch sein?
Auch das ist fast nie ein Knockout-Kriterium. Aber wenn ein diskursives Format eingereicht wird, bei dem zehn Männer am Podium sitzen, dann würde ich es definitiv ausschließen, außer es kann nachvollziehbar dargestellt werden, warum ein Antrag in dem Fall nicht geschlechterparitätisch ist.
Wie wichtig ist die formale Gestaltung? Muss ein Antrag schön sein?
Schlecht ist, wenn ein Antrag hässlich ist. Jury-Mitglieder, Beiratsmitglieder haben oft wenig Zeit für die Bewertung, das heißt, da geht es tatsächlich auch darum, den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Man muss aber jetzt kein_e Grafiker_in sein oder eine_n Grafiker_in beauftragen.
Kann man Jurys überraschen, provozieren, anregen? Ist das hilfreich, weil man so im Gedächtnis bleibt?
Ja, das kann durchaus von Vorteil sein. Zu viel Schmäh zu führen, kann aber auch nach hinten losgehen. Ansonsten gibt es viele Möglichkeiten an Überraschungen – auf inhaltlicher, aber auch auf gestalterischer Ebene. Eine extrem professionelle Ausarbeitung kann überraschen, mit drei, vier, fünf Details, auf die der Blick gelenkt wird, oder mit einem anderen Gestaltungsformat, sofern es zulässig ist. Ich sage immer „MDAGH – mach, dass andere genau hinschauen“.
Wie schafft man das?
Nimm dafür die andere Rolle ein, mach die Augen zu und stell dir ein Jury-Mitglied vor. Überleg, wie es deinen Antrag wahrnehmen könnte. Ich glaube, dieser Perspektivenwechsel, dieses ‚Nachvollziehen‘ ist zentral. Man sollte sich hineinversetzen und vorstellen können, wer den Antrag liest und was diesen Personen wichtig sein wird.
Wie ehrlich sollte man denn in einem Antrag sein?
Zwischen der Einreichung, die abgegeben wird, und dem, was dann tatsächlich passiert, ist ein beträchtlicher Spielraum gegeben. Es muss nicht unbedingt alles 1:1 umgesetzt werden, was eingereicht wurde. Es gibt gewisse Entwicklungsmöglichkeiten. Vielen ist das nicht bewusst. Natürlich sollte ein Antrag wahrheitsgemäß sein und die Umsetzung nahe dran bleiben, aber es gibt dennoch Handlungsspielraum. Der Antrag und seine Umsetzung sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die aber zu einem Menschen gehören.
Thomas Philipp ist Leiter des Linzer Instituts für qualitative Analysen (LIquA), Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Kulturpolitik OÖ und Teil der KUPF OÖ-Mitgliedsinitiative qujOchÖ. Seine Jury- bzw. Beiratserfahrung reicht von Interessenvertretungs-geführten Ausschreibungen wie TKI open und dem KUPF-Innovationstopf, bis zum Kulturinitiativenbeirat des Kulturministeriums.
Zum Gendern:
Wie die geschlechterneutrale Sprache in einem Antrag letztlich aussieht, ist nebensächlich. Nicht nebensächlich insgesamt, auch für mich persönlich nicht, da der Stern etwas anderes aussagt als der Unterstrich, das Binnen-I, oder eine wechselnde weibliche und männliche Bezeichnung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie geschlechtsneutral formuliert werden kann, aber generell gilt: Ja, bitte, unbedingt.