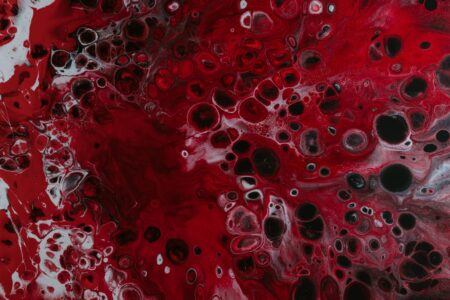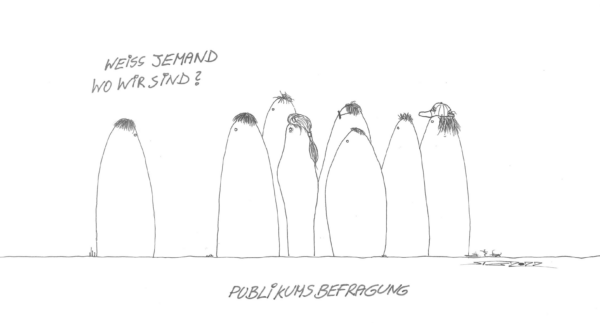Es besteht auf den ersten Blick Einverständnis darüber, was private und öffentliche Räume für das Individuum jeweils bedeuten. Wir gehen davon aus, dass dies Räume sind, in denen das ‹individuelle.Selbst› entsprechend seiner Bedürfnisse und Erkenntnisse (re)agiert. Wir bauen immer noch Grenzen und Mauern, schließen uns in Räume ein, die in anderen Räumen eingeschlossen sind, wie eine Matrjoschka. Alles, was wir in diesen umschlossenen Räumen tun, ist sehr ‹privat›. Trotzdem, die Beschlüsse und Maßnahmen der Regierung angesichts Corona legen nahe, dass das Gefühl – «Das ist mein Leben, ich treffe meine eigenen Entscheidungen» – vielleicht immer schon trügerisch war. Zuvor hätte man meinen können, dass es eine individuelle Entscheidung ist, ob man andere in die eigenen vier Wände einlädt oder nicht. Nun sehen wir eine Vermischung von Privatraum und Arbeitsplatz (für die, die privilegiert genug sind, noch Arbeit zu haben, die sie im Homeoffice machen können). Wurden diese Grenzen also einfach ausgesetzt, aufgelöst oder bestanden sie vielleicht nie? Die gegenwärtige Krise bringt nicht nur neue Definitionen von Privatheit und Öffentlichkeit ans Licht, wir haben es auch mit neuen sozialen Praxen von körperlichem Ausdruck und Interaktion zu tun. Ich habe zum Beispiel geglaubt, dass die Möglichkeiten, körperliche Intimität auszudrücken – ein Kuss auf die Wange, ein Handschlag, eine Umarmung – von mir bestimmt wurden, dass ich dabei bewusste Entscheidungen traf. Nun gibt es Regulierungen zum Schutz der Gesellschaft, die suggerieren, dass diese Handlungen nie meine individuelle Entscheidung waren. Ist es vielleicht so, dass der Körper, der als das Zentrum der Privatheit eines Individuums angenommen wird, gleichzeitig Zentrum der Öffentlichkeit ist? Letztendlich also ein ‹kollektives Ich›? Wie ehrlich können wir im digitalen Zeitalter überhaupt von ‹unserem Leben› sprechen, wenn wir freiwillig persönliche Daten teilen, die verändert, gehackt und wiederverwendet werden? Vielleicht müssen wir lernen, zwischen ‹körperlichem.Selbst› & ‹digitalem.Selbst› zu unterscheiden, um als Gesellschaft zu wachsen.
Aus dem Englischen übersetzt von Katharina Serles.