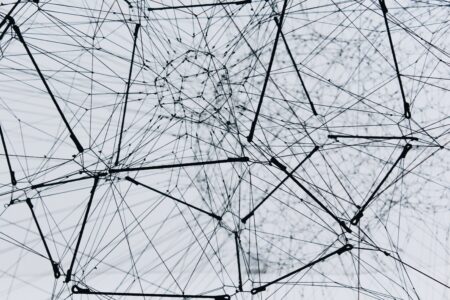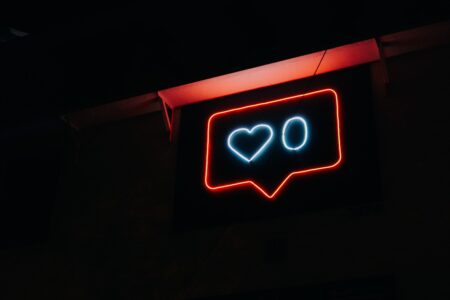Das, was gerade mit uns allen geschieht, hinterlässt bleibende Spuren. Von der Erinnerung an bittere Existenzängste bis hin zu tatsächlichen Verlusten. Kunst erinnert sich, reflektiert und verarbeitet. Carmen Bayer blickt Post-Corona und fragt sich, ob eine eingeschränkte Kultur eine beschränkte Gesellschaft bedeutet.
Durch die Krise suchen viele Individualkämpfer*innen, Vereine und Kollektive fieberhaft einen gangbaren Weg zwischen der utopischen Vorstellung neuer sozialpolitischer Systeme und einem drohenden Sparkurs. Wie wird die Kunst Post-Corona aussehen? Wie sehr wir an einem Scheideweg stehen und was das ‹Biotop Kulturnation› hervorbringen kann, zeigen zwei spekulative Blicke in die Zukunft:
Dystopische Zeiten
Selbstverständlich wird es auch in der Post-CoronaKulturnation weiterhin Fördertöpfe geben, denn was wären wir sonst, wenn die Kultur vor der Nation wegbräche? Aber was und wie viel wird noch gefördert, wenn das Geld knapp ist? Was, wenn sich auch nach der Krise der erhoffte Systemwandel nicht wie ein zarter Schleier über das kapitalistische Mantra der Regierungen gelegt hat?
Kleinstprojekte, deren Mehrwert unmöglich an Zahlen gemessen werden kann, bekommen Schwierigkeiten dabei, als förderwürdig zu gelten. Kulturelle Leistungen werden nur noch in Zusammenhang mit Nächtigungszahlen diskutiert. Aus Besucher*innen werden Konsument*innen, die Kunst zum Marktplatz. Gefördert wird, wer den Vorstellungen der Touristik entspricht und schwarze Zahlen schreibt. Auch der Kulturtreibenden letzte Bastion, das kritische Publikum, wird sich nicht empören über geistlose Darbietungen.
Wer wird gegen ein autoritär anmutendes System aufstehen, daraus Kunst machen und diese als Betrachter*innen reflektieren? Niemand wird diese Kunst sehen, weil es sie nicht gibt. Niemand wird von selbst darüber nachdenken, weil das nicht erwünscht ist. Kinder zeichnen statt eigenen Vorstellungen den Bundeskanzler im Portrait, Jugendliche müssen ihre Zukunft planen und dem Konkurrenzkampf in der Schule standhalten. Keine Zeit für Rebellion. Alles, was sich gegen den Mainstream verhält, wird gemeldet; wie das geht, konnte in der Krise erprobt werden. Die Meinung der Wenigen wird zum Schutz der Vielen ignoriert. Wovor wir uns schützen, wird bis dahin aber niemanden mehr kümmern.
Lernen aus der Krise — das utopische Zeitalter
Es kann aber auch ganz anders kommen: Nachdem kurzfristig der gesamte Kunst- und Kulturbetrieb, von Popkultur, Alltagskunst bis zur Hochkultur wegbricht, erkennt die Gesellschaft, dass etwas fehlt. Nicht nur die eigene Vorstellung von ‹wahrer› Kunst, sondern gerade das ‹Andere›, das widerspenstige «Gschra» im Radio oder das Kunstwerk, das die 3-Jährige auch hätte malen können, werden fehlen. Vielfalt wird neu zu schätzen gelernt und anstatt des ewigen Konfliktes um Wertehoheit gilt Diversität als neues Ideal.
Ambiguitätstoleranz einzufordern und zu fördern, also das Aushalten von Widersprüchen und Unsicherheiten, wird zum neuen staatspolitischen Ziel. Dieses Mantra erlaubt es der Kultur, ebenso kommerziell und gewinnbringend zu sein, wie ein Nischenerlebnis für wenige. Mut zum Selbstzweck wird gefördert werden, große publikumsträchtige Aktionen werden respektiert.
Die Politik wird verstanden haben, dass Hochkultur oder der österreichische Traditionskult für sich allein schnell trist werden. Mehr noch, um weiterhin den Status als Kulturnation aufrecht zu erhalten, werden Fördertöpfe gefüllt, Bedingungen erleichtert und wird vor allem die Wertschätzung Kunst- und Kulturarbeiter*innen gegenüber erhöht. Sichtbar wird diese neue Anerkennung auch in strukturellen Fragen. Der Wohlfahrtsstaat hat seine Aufgabe wiedergefunden und die Politik erkannt, dass mit dem Ende von existenzbedrohenden Lebenslagen auch neidische Blicke nach oben und abwertende Tritte nach unten an Nährboden verloren haben. Rechtfertigungszwänge, chronische Existenzängste und ein prekäres Dasein als Lebensstil sind inzwischen Teil einer vergangenen Zeit. Das kollektive Schockerlebnis wird unsere Prioritäten verschoben haben, der Leistungsbegriff wird zur Nebensache.