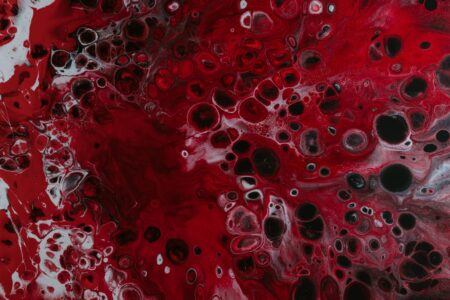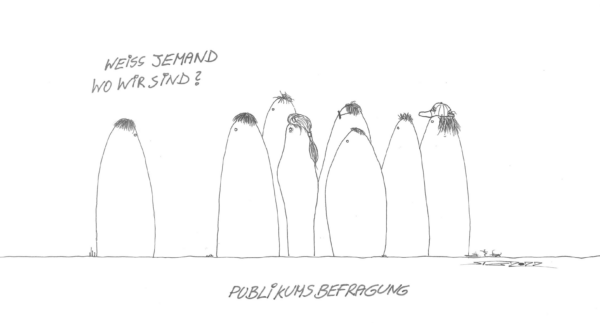Längst ist die Klimakrise in der Kunst angekommen: von Opernsänger*innen, die sich über die kerosinreiche Reisesucht der Gegenwart auslassen, über Technikschrott bis zu SciFi-Pflanzen, die über die Zukunft spekulieren … Friederike Sigler analysiert die Inhalte und Bedingungen von Kunst bei der Venedig Biennale 2019.
Klar, die Biennale ist kein Querschnitt durch die aktuelle Kunstproduktion. Sie unterliegt kuratorischen Entscheidungsprozessen darüber, was gerade en vogue ist und ein wenig provoziert, weil sie sich gerne politisch gibt. Entsprechend lautet das diesjährige Motto des US-amerikanischen Kurators Ralph Rugoff «May You Live In Interesting Times». Außerdem ist Klima kein neues Thema in der Kunst. Spätestens seit den 1970er Jahren arbeiten sich Künstler*innen an den Veränderungen der Natur ab. Aber ob nun 2019 das Kunst-Klima-Jahr ist, oder ob die letzten 50 Jahre Kunst-Klima-Jahre waren – who cares. Viel interessanter ist doch, wie sich die künstlerischen Positionen damit beschäftigen und was sie dazu zu sagen haben.
„Interesting Art“ in „Interesting Times“
Beginnen wir mit der diesjährigen Gewinner des Goldenen Bären, der Arbeit Sun & Sea (Marina) im litauischen Pavillon. Dafür haben die Künstlerinnen Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė und Lina Lapelytė eine ständig wechselnde Truppe aus Opernsänger*innen und Anwohner*innen zusammengestellt, die in Badekleidung auf einem künstlich aufgeschütteten Strand in einem Lagerhaus eine Oper singen. Die Szenerie sieht zugleich einladend aus und auch nicht. Denn sobald die Akteur*innen ihre Stimmen erheben, geht es in Sun & Sea (Marina) nicht mehr um die Idylle einer Strandlandschaft, sondern um eine Gesellschaft, die, um dem neoliberalen Arbeitsrhythmus Stand zu halten, auch den Urlaub zum Abenteuer machen muss, die zweimal im Jahr um die halbe Welt zum Great Barrier Reef jettet und die in ihrer Ortlosigkeit offenbar das Verantwortungsgefühl für den eigenen CO2-Fußabdruck verloren hat.
Auch beim Publikumsliebling Deep See Blue Surrounding You im französischen Pavillon geht es ums Reisen. Im filmischen Mittelpunkt steht ein Roadtrip der Künstlerin Laure Prouvost mit einem (fast emissionsfreien) Pferd, einem Auto und einem Boot von den Pariser Banlieus bis zur Lagunenstadt. Um zum Film zu kommen, müssen sich die Besucher*innen am weiß-dampfenden Tor vorbei zum Hintereingang schlängeln bis zu einer Epoxidharzfläche, die mit Müll versehen ist und dabei in etwa so aussieht, wie der Meeresboden, dem der Meeresspiegel abhanden gekommen ist. Eine surreale Dystopie einer Welt, die mit der Natur vereint ist und zugleich abgeschlossen hat.
Solche Müllplantagen sind auch im Pavillon Ghanas zu finden, der, im Übrigen zum ersten Mal auf der Biennale vertreten, gleich sechs Künstler*innen versammelt. Dazu gehört El Anatsui, der in ein riesiges Netz plattgewalzte Aluminium-Korken und Dosen in einer gelb-braunen Wandteppichfläche eingefasst hat. Recyclingkunst sozusagen. Dazu gehört Ibrahim Mahama, der mit einem Netz arbeitet, das gewöhnlich für das Räuchern von Fischen eingesetzt wird. Gemeinsam mit den zugehörigen Versatzstücken seiner Installation, unter anderem ein riechendes Stück getrockneter Fisch, adressiert der Künstler die Fischräucherindustrie, die zu den zentralen Einnahmequellen der ghanaischen Bevölkerung gehört – und gleichermaßen durch den Klimawandel als erstes betroffen sein wird. Und dazu gehört John Akomfrah, der für seinen Drei-Kanal-Film The Elephant in the Room – Four Nocturnes drei Erzählungen miteinander verwebt, die längst miteinander verwoben sind: die Kolonialisierung Ghanas, die von dauer-fliehenden Elefanten und die der durch die Sahelzone in Richtung Europa flüchtenden Menschen. Kolonialismus, Klimawandel und Migration gehören bei Akomfrah zusammen und sind zugleich Symptom einer Gegenwart, in der die Spaltung der Welt am Leben erhalten wird.
Es ist nicht zu übersehen: Klimakritik heißt im Fall dieser künstlerischen Positionen immer auch Systemkritik. Der Klimawandel wird maßgeblich durch einen neoliberal regierten Kapitalismus befördert, durch die immer-reisenden Ortlosen und ihre Vorliebe für Plastik sowie durch ein Missverhältnis zur Natur und dem Ökosystem, und trägt dazu bei, dass Menschen fliehen und den Weg über die tödlichste Grenze der Welt, das Mittelmeer, in Kauf nehmen. Hier wird also nicht gekuschelt, denn hier geht es nicht um ein Grad. Diese Künstler*innen halten es vielmehr mit dem radikalen Flügel der Klimabewegung: «System Change not Climate Change». Es sind ganz klar die Bedingungen, die überhaupt erst zu der Misere der Gegenwart geführt haben und die sich zuallererst verändern müssen, um über klimafreundlichere Gesellschaftskonzepte nachzudenken, so die Künstler*innen. Für diejenigen, die es etwas detaillierter angeleitet haben wollen, sei der Besuch der Biennale ans Herz gelegt.
Apropos besuchen:
Auf der Biennale fällt auch auf, dass die künstlerischen Positionen zahlreiche Facetten des Klimawandels unter die Lupe nehmen – aber Venedig, den Schauplatz der Ausstellung, und den Wandel, auf den die Lagunenstadt zusteuert, weitgehend außen vor lassen. Dabei ist ihr Versinken auch von den Superyachten der Superreichen zu verantworten, die alle zwei Jahre bis zum Eingang der Giardini vorfahren und dabei mit ihren überdimensionalen Statussymbolen die Sicht blockieren. Deren Auftritt ist wiederum bedingt durch eine globalisierte Kunstwelt, für die es normal geworden ist, für Ausstellungen durch die halbe Welt zu jetten. Das Kunstsystem, um die Lieblingskritikerin der Kritiker*innen, Hito Steyerl, zu zitieren, «reflektiert nicht bloß, sondern interveniert aktiv in den Übergang in eine neue Weltordnung nach dem Kalten Krieg». Denn: «Zeitgenössische Kunst ist eine zentrale Akteurin […] im Semiokapitalismus, wo immer T-Mobile seine Flagge hinsetzt.» Viele mögen einer solchen Systemkritik überdrüssig sein und stempeln diese als reaktionär ab. Aber wenn sogar die Künstler*innen auf einer Mega-Ausstellung wie der Biennale die Bedingungen zur Debatte stellen, unter denen wir leben, dann müssen wir auch die Bedingungen neu reflektieren, unter denen Kunst gemacht, gezeigt und betrachtet wird.