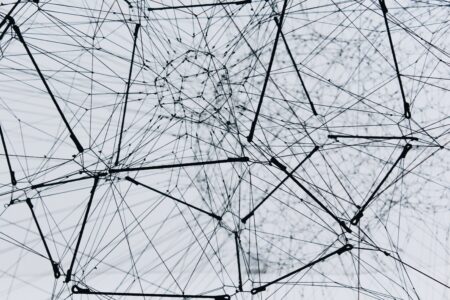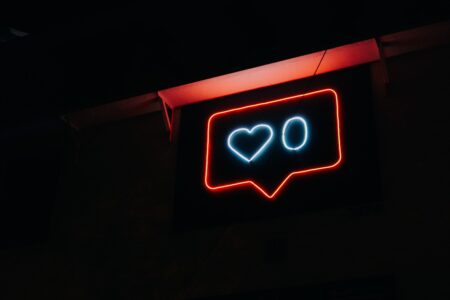Von Kultur- und Unternehmensleitbildern bis hin zu „Leitkulturen“ ganzer Staaten soll alles anhand eines festgelegten Ideals organisiert werden. Nicole Schöndorfer fragt, warum es gleichzeitig als naiv gilt, das auf eine Gesellschaft umzulegen, in der Kapitalismus und Patriarchat als überwunden gelten.
«Wie soll das gehen?» Im Gespräch mit vermeintlichen Pragmatiker*innen wird schnell deutlich, welchen Stellenwert dezidiert linke, feministische und antikapitalistische Positionen im öffentlichen politischen Diskurs haben. Sie gelten als einfältig und unbedarft, als utopisch. Je nach Radikalität auch gerne als gefährlich für die demokratische Ordnung. Außerdem wesentlich bei der Beurteilung: Wer sind diejenigen, die Ideen vorbringen? Wieviel Macht haben sie? Im Regelfall deutlich weniger, als jene in politischen Entscheidungspositionen. Deshalb wird abgewunken.
«Keine Grenzen?», «Keine Diskriminierung?», «Keine Klassen?», «Das gute Leben für alle?» – «Wie soll das gehen?» Wer nicht sofort einen 100-Punkte-Plan für die Politik der nächsten Jahre vorlegen kann, hat sich für eine Diskussion auf Augenhöhe disqualifiziert. Der Plan muss vor allem unter den vorherrschenden Rahmenbedingungen durchzuführen sein, denn umgeworfen soll damit nichts werden. Revolutionäre Ideen sind nicht vorgesehen.
Der Status quo als Machtgarant
Utopien sind Entwürfe für eine Gesellschaft, die frei ist von in der gegenwärtigen Realität herrschenden Zwängen und Hierarchien. Sie sind fiktive Konzepte für ein besseres Zusammenleben in einer nicht datierbaren Zukunft, dem es sich nach und nach anzunähern gilt. Fassbar werden sie durch konkrete Maßnahmen, die für sich allein gar nicht so schwer umzusetzen wären. Zumindest nicht so schwer, wie es die Machthaber*innen, die sich gegen diese Form der Herrschafts- und Systemkritik wehren, vorgeben. Ihre Beweggründe sind nicht schwer zu durchleuchten. Sie haben kein Interesse an der Veränderung des Status quo. Als jene, die über politische, wirtschaftliche und kulturelle Macht verfügen, profitieren sie ja von ihm. Gleichberechtigung ist den Hierarchien hinderlich.
Die Erkenntnis ist nicht neu. Die ursprüngliche Idee der Utopie wird dem englischen Politiker und Autor Thomas Morus zugeschrieben, der anhand der
Insel «Utopia» in seinem gleichnamigen Roman aus dem 16. Jahrhundert den «besten Zustand des Staates» beschreibt. Seine Vorstellung von einer idealen Gesellschaft bildete das Fundament für das Genre der Sozialutopie, die beständig weiterentwickelt wurde und wird. Von der russischen Revolutionärin und Schriftstellerin Alexandra Kollontai, für die die feministische Utopie eine sozialistische sein musste und umgekehrt, bis hin zu Ines Kappert, der Leiterin des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung. In einem Interview mit SPIEGEL ONLINE spricht sie 2015 von einer feministischen Perspektive als «herrschaftskritische[r] Perspektive, die das Gegebene nicht hinnimmt und eine gewalt- und diskriminierungsfreie Welt zum Ziel hat, in der Geschlecht kein Platzanweiser mehr ist» und fügt hinzu, dass diese Welt «Lichtjahre» entfernt liege.
Gleichberechtigung ist weit weg, aber fassbar
Bis heute stellen Utopien für Ausgebeutete und Ausgegrenzte einen unerlässlichen Antrieb für eine lebenswerte Zukunft dar. Der deutsche Philosoph Ernst Bloch schuf mit dem Begriff der «konkreten Utopie» eine Antwort auf die marxistische Utopie-Kritik, die besagt, dass Utopien nur abstrakte Gebilde ohne ernsthaftes Veränderungspotenzial für die Gesellschaft sein könnten, sofern sie nicht gleichzeitig die ökonomischen Bedingungen herausfordern und neu formen würden. Konkrete Utopien streben nach durchaus realistischen, wenn auch weit von der Gegenwart entfernten Zielen. Wie Leitbilder? Die direkte Analogie von Leitbild und konkreter Utopie ist natürlich verkürzt, aber sie ist auf keinen Fall willkürlich.
Gleichberechtigung ist ein dankbares Beispiel für eine konkrete Utopie. Sie ist weit weg, aber fassbar und beschreibbar und theoretisch wissen alle, was es brauchen würde, um sie Realität werden zu lassen. Sie ist ein realistisches Ziel, genauso wie es ein realistisches Ziel ist für ein Unternehmen, etwa sein Team divers zu gestalten. Ein Punkt, der wahrscheinlich im Unternehmensleitbild verankert sein wird. Kaum jemand würde das Vorhandensein einer solchen Vorgabe als naiv und unbedarft bezeichnen. Warum sollen Utopien es dann sein?
Wer mitgestalten kann und wer nicht
Ähnliches gilt für Kulturleitbilder und für die so oft zitierten ‹Leitkulturen› ganzer Staaten. Nirgendwo wird an der Umsetzbarkeit dieser selbstgesteckten Ziele gezweifelt. Aber sie sind eben nicht revolutionär gestaltet, sondern so, dass sie dem Machterhalt derjenigen dienen, die sie aufs Parkett bringen. Sie dienen dem Erhalt der Hegemonie. Utopien sind hingegen immer per se antihegemonial als etwas, das von ‹Unten› kommt. Deshalb sind sie auch so bedrohlich für ‹Oben› und müssen schnell als nicht ernst zu nehmende Gedankenspielerei delegitimiert werden. Wie bedrohlich sie wirken, zeigte kürzlich auch die Kontroverse um den Jusos-Vorsitzenden Kevin Kühnert, der es gewagt hatte, antikapitalistische Thesen als Alternative zum System aufzubringen. Das wurde dann selbst von Seiten der SPD als sozialistischer Affront diffamiert. In einer Gesellschaft, in der Kapitalismus als default gilt, muss ‹sozialistisch› natürlich eine Beleidigung sein. Dabei gehört Kühnert als weißer Mann in einer politischen Position noch zu jenen, deren Ideen zumindest angehört werden. Er kann dadurch potenziell mitgestalten. Frauen, nicht-weiße und queere Personen werden hingegen kaum nach ihren Thesen gefragt und hatten und haben aus diesem Grund kaum Möglichkeit, mitzureden. Dabei unterscheiden sich ihre Bedürfnisse oft dramatisch. Sie dürfen beim Gedanken an eine lebenswerte und gleichberechtigte Zukunft, an eine feministische Utopie, nicht weiter außer Acht gelassen werden.
Nicole Schöndorfer lebt als freie Journalistin und Medienmacherin in Wien. Sie setzt sich vorwiegend mit feministischen Themen auseinander und diskutiert gesellschafts- und medienpolitische Aspekte.