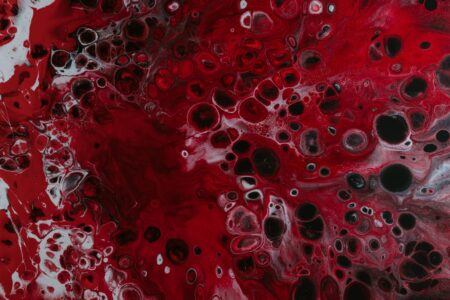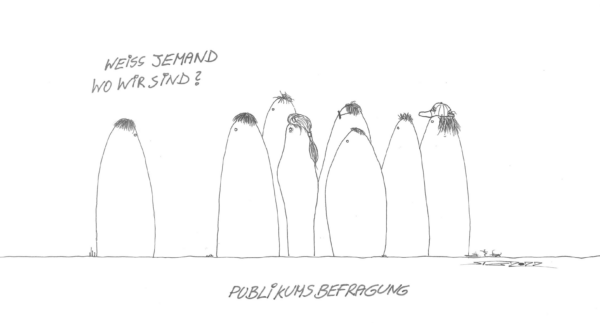Sind Feminismus und Identitätspolitik eine Sackgasse, aus der nur Klassenkampf wieder herausführt? Von Brigitte Theißl
Das Konzept der Klasse erlebt unter Feministinnen ein Comeback. Die von Linken geforderte Rückbesinnung weg von „Identitätspolitik“ hin zum Klassenkampf läuft allerdings ins Leere: Komplexe Machtverhältnisse lassen sich weder auf die soziale Frage noch das Geschlechterverhältnis reduzieren.
Nach dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps im November 2016 suchten in den USA Linke und Liberale händeringend nach Erklärungen: Wie konnte ein frauenverachtender Immobilien-Tycoon, der hasserfüllte Reden schwang, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden? Ein Sündenbock war schnell gefunden: Kontrahentin Hillary Clinton hätte im Wahlkampf auf «Identitätspolitik» gesetzt, gezielt Frauen, Schwarze und LGBT-Personen adressiert – die «vergessene» weiße Landbevölkerung hätte sich so in die Rolle der diskriminierten Minderheit gedrängt gefühlt. Dass Trump im sogenannten Rust Belt, in Staaten wie Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin punkten konnte, veranlasste einige Beobachter*innen schließlich zur Analyse, die Linke müsste sich endlich wieder der Klassenfrage widmen – und damit jenen arbeitslosen und resignierten Stahlarbeitern, die für Trump stimmten. Das Bild der Arbeiter*innenklasse dahinter blendet gesellschaftliche Realitäten freilich aus: In den Köpfen vieler Menschen sind «Arbeiter» immer noch (weiße) Männer, die am Bau und in der Fabrik schuften, Frauen und Migrant*innen in prekären Dienstverhältnissen in der Pflege, in der Gastronomie oder in Reinigungsfirmen bleiben außen vor.
Schwieriges Klassenverhältnis
Die Debatte um die angeblich fehlgeleitete Identitätspolitik der Linken trifft auch feministische Bewegungen. Kritik wird dabei allzu oft polemisch formuliert und richtet sich vornehmlich gegen das Schreckgespenst Political Correctness, queere Theorie und Binnen-I. Statt für armutsgefährdete Alleinerzieherinnen und ausgebeutete Textilarbeiterinnen zu kämpfen, widmeten sich moderne Feministinnen lieber komplizierten Sprachregelungen und non-binären Toilettenräumen: neoliberale Symbolpolitik statt Klassenkampf, so das hämische Resümee. Dass Klasse lange Zeit keine relevante Kategorie feministischer Wissensproduktion war, ist tatsächlich nicht ganz falsch – und erklärt sich historisch. In den 1970er Jahren wehrten sich (marxistische) Aktivistinnen der zweiten Frauenbewegung in Europa gegen die eigenen Genossen, die die Unterdrückung von Frauen zum «Nebenwiderspruch» erklärten: Mit der Überwindung des ausbeuterischen Kapitalismus erledige sich auch die Frauenfrage, so das linke Credo. Unbezahlte Reproduktionsarbeit wie Kindererziehung und Altenpflege, die heute noch überwiegend von Frauen geleistet wird, kam in diesen Überlegungen schlicht nicht vor. Auch akademisch konnte die feministische Klassenanalyse schwer Fuß fassen. Als sich die Frauenforschung (später Geschlechterforschung und Gender bzw. Queer Studies) an den Universitäten etablierte, fungierten feministische Theoretiker*innen zunehmend als Impulsgeber*innen feministischer Bewegungen, was nicht nur eine theoretische Ausdifferenzierung, sondern auch neue, klassenspezifische Ausschlüsse mit sich brachte. Mit der sogenannten linguistischen Wende innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften passierte zudem eine Hinwendung zu Sprache – weg von ökonomischen Realitäten. Feministinnen interessierten sich zunehmend für die Konstruiertheit von Geschlecht, Begehren und sexueller Identität, materialistischer bzw. marxistischer Feminismus geriet zumindest an den Universitäten ins Hintertreffen.
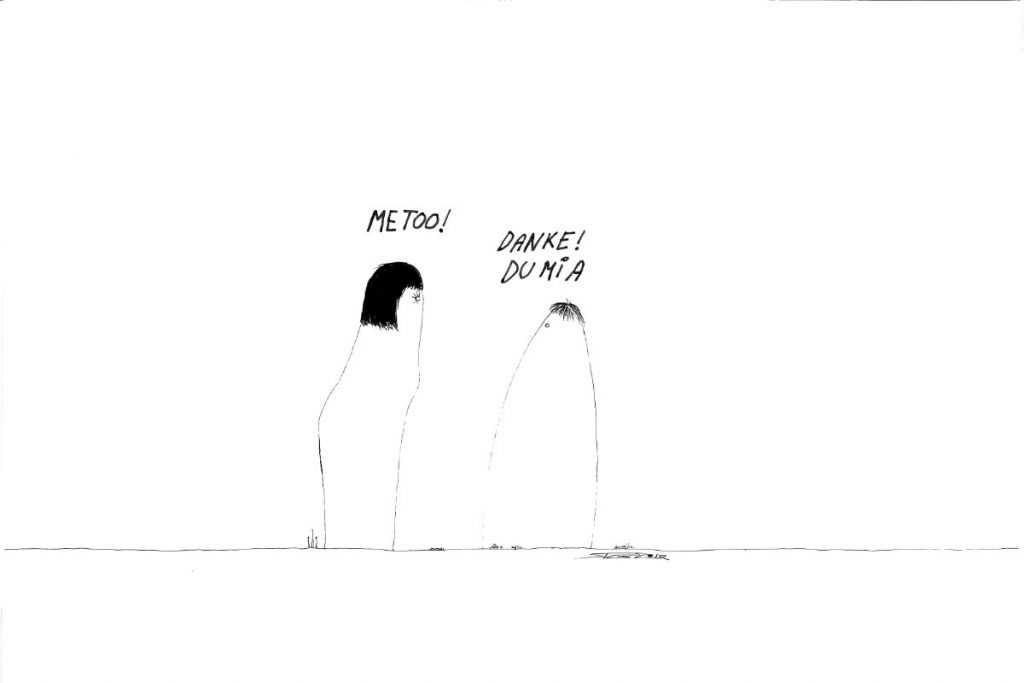
Scheingefecht
Die Marginalisierung der Klassenfrage in feministischen Kreisen bricht nun langsam auf: Auch wenn intersektionale Analysen – also die Überschneidung verschiedener Machtachsen bzw. Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus und Homofeindlichkeit – längst Basis jeder differenzierten feministischen Debatte sind, bleibt «Klasse» nach wie vor oft ungeliebtes Anhängsel – das auch zur Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien zwingen würde. Eine Wiederentdeckung des Klassenbegriffs kann sich für di e feministische Analyse (globaler) Ausbeutungsverhältnisse somit nur als äußerst nützlich erweisen – ein Widerspruch zu emanzipatorischen Frauen-Kämpfen ergibt sich daraus jedoch keineswegs.
e feministische Analyse (globaler) Ausbeutungsverhältnisse somit nur als äußerst nützlich erweisen – ein Widerspruch zu emanzipatorischen Frauen-Kämpfen ergibt sich daraus jedoch keineswegs.
Die Polemiker*innen rief zuletzt die Debatte um sexuelle Gewalt (#MeToo) erneut auf den Plan. Publizisten, wie der Philosoph Robert Pfaller, orten – insbesondere unter Feministinnen – eine Empörungslust und Hypermoral, die die «eigentlichen» Probleme verdecke: So würde ein Politiker heute viel eher über den Vorwurf sexueller Belästigung stolpern als über Waffendeals oder die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten. Solch konstruierte Gegensätze entpuppen sich freilich als rhetorische Tricks, die sich gegen die berechtigten Anliegen feministischer Aktivistinnen wenden: So zählt das Recht auf ein gewaltfreies Leben zu den ältesten Forderungen der Frauenbewegung überhaupt – eine Forderung, die sich nicht in der Klassenfrage erschöpft.
Globale Kämpfe
Dem engen Blick der Kritiker*innen entgehen nicht zuletzt Frauen*kämpfe rund um den Globus, die sich in Pakistan und Argentinien, ebenso wie in Polen und Österreich gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen, gegen Frauenmorde und Gewalt im sozialen Nahraum richten und für die Rechte von Sexarbeiter*innen, das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und eine gerechte Klimapolitik eintreten. Auch in den USA ist die schlagkräftigste Stimme gegen die unsoziale und rassistische Politik der Republikaner*innen unter Donald Trump eine feministische. In der vielfältigen «Women’s March»- Bewegung finden sich Forderungen der Gewerkschaft ebenso wie jene einer angeblichen Symbolpolitik. «Wer sich ernsthaft mit politischen Perspektiven und emanzipatorischer Politik auseinandersetzen will, dem sollte klar sein, dass es nicht um ein Entweder-oder von Umverteilungs- oder Anerkennungspolitiken geht, sondern um deren Synthese – so schwierig das sein mag», schreibt die Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiss im «Standard».
Weiterlesen:
„Wir legen selbst fest, wie lange es uns gibt“: Die Vereine maiz und FIFTITU% sind von massiven Kürzungen bedroht
Kindergartengebühr frisst Familienbonus: Wie schwarzblaue Familienpolitik manche Familien begünstigt, statt flexible Kindergartenöffnungszeiten für alle zu ermöglichen.