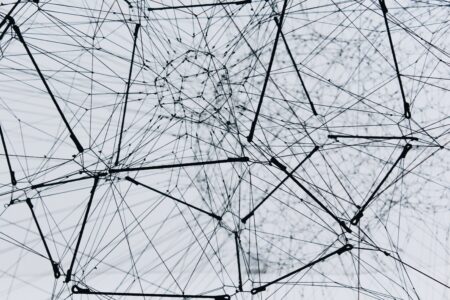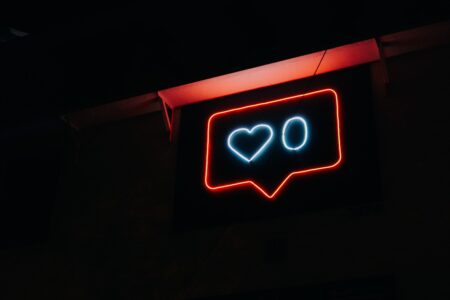Kulturpolitik ist Standortpolitik. Das gilt weniger für Tourismus und Hochkultur, als vielmehr für Initiativen und Subkultur abseits der Ballungsräume. Widerstand als Selbstzweck allerdings ist vor allem eines: lächerlich.
„Dort gibt es ja sonst nix!“
Keinen Satz, kein Argument habe ich im zurückliegenden Jahrzehnt häufiger gehört als dieses. Richtig, wir sprechen von sogenannten benachteiligten Regionen – jene Gegenden, welchen sich all die schönen politischen Strategien für den ländlichen Raum widmen, in denen das Kulturleben viel zu selten ernsthaft mitgedacht wird. Wenn der Vorwurf, es gebe hierzulande keine Kulturpolitik, ein berechtigter ist, dann wiegt jener, dass es kaum kulturpolitische Überlegungen für ländliche Gegenden gibt, umso schwerer. Tatsache ist: Viele der hehren Ansprüche und Förderideale haben in den Niederungen der Kulturförderung verdrängt zu werden – weil es das berechtigte Anliegen gibt, möglichst überall Initiativen zu unterstützen, Kulturarbeit zu ermöglichen. Ich spreche aus meiner Erfahrung als Kulturinitiativenbeirat des Bundeskanzleramts und als Jugendkulturbeirat in Niederösterreich: Sofern eine Einreichung nicht klar den Förderrichtlinien widerspricht, dann bleibt und blieb das «Dort gibt es ja sonst nix!» ein Killerargument gegen so manchen inhaltlichen Einwand. Das bedeutet: Der Kontext bestimmt immer mit darüber, was relevant bzw. regional relevant ist. Veranstaltungen, die schon in größeren Kleinstädten nie und nimmer gefördert würden, gelten in strukturell benachteiligten Gegenden als gewagt, mutig, meinetwegen sogar «innovativ».
Oasen
Um nicht falsch verstanden zu werden: Abseits der Hauptstadt und der drei, vier anderen nennenswerten Ballungsräume herrscht in Österreich alles andere als Wüste. Oft gedeiht in Oasen Prächtiges. Die Qualität allerdings ist höchst unterschiedlich. Für die FördergeberInnen wie auch für die diesbezüglich Empfehlungen abgebenden Beiräte lässt sich die Qualität aus der Distanz oft schwer einschätzen. Das Dilemma: Je dezentraler und vielfältiger das Ermöglichte, desto schwerer fällt das Abschätzen. Und für eine Evaluierung fehlen Zeit (den Beiräten) wie Geld (den Förderstellen). Auch die mediale Resonanz ist meist nicht gegeben. Nicht nur den Kulturinitiativen, Künstlerinnen und Künstlern in ländlichen Gegenden fehlen die medialen Sparring-PartnerInnen. Ernstzunehmende Auseinandersetzung findet viel zu selten statt. Vieles passiert im kritiklosen Raum. Doch anstatt darüber zu jammern, dass die traditionellen Medien wenig oder nicht berichten, geht es über soziale Medien einfacher denn je, sich eigene Kommunikationskanäle aufzubauen. Kurzvideos, Hinweise auf Austausch, Fürsprache und Kritik und auch alle andere Formen der rein formalen Dokumentation helfen wiederum auch FördergeberInnen, die Sache einzuschätzen. Es geht dabei ausdrücklich nicht um Quote oder Quantität: Doch Initiativen, denen es gelingt, glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Angebot auch angenommen wird, vielleicht sogar einzigartig ist, die werden es künftig leichter haben, Fördermittel und Sponsorengelder zu bekommen. Dass Kulturinitiativen immer öfter wie urbane Milieus und stark vernetzt funktionieren, dürfte ihre Rolle künftig stärken.
Wobei nicht wenige Kulturinitiativen auch 2017 noch unter einer Fehleinschätzung leiden: Sie sehen sich als Arbeitnehmerinnen. Auch ihre Interessenvertretungen agieren mitunter wie Gewerkschaften, nicht wie Arbeitgebervertretungen. Denn die meisten Kulturinitiativen sind letztlich ArbeitgeberInnen und sollten auch so handeln; aktiv, eigenverantwortlich und selbstbewusst gegenüber FördergeberInnen, MitarbeiterInnen, SponsorInnen. Die Folgen dieser Fehleinschätzung?
„Da gibt es eine erschütternde Flucht vor der eigenen Verantwortung. Wenn zu wenig Geld da ist, sind immer die anderen schuld,“
meint ein in der Szene bestens vernetzter Akteur, der namentlich nicht genannt werden möchte.
Widerstand als Selbstzweck ist vor allem lächerlich
Gar nicht wenige Initiativen sind gedanklich auch insofern in den 70er oder 80er Jahren hängen geblieben, als sie sich prinzipiell als «widerständig» sehen. Dazu ist zu sagen: Widerstand als Selbstzweck ist vor allem lächerlich. Initiativen, die langfristig erfolgreich sind,pflegen immer auch Beziehungsarbeit zu FördergeberInnen und privaten SponsorInnen. Das bedeutet freilich nicht, dass hier keine kritische Arbeit möglich ist, ganz im Gegenteil. Diese wird geschätzt, bewusst und gern unterstützt – gerade von den zuständigen und an der Sache interessierten BeamtInnen. Und im Gegensatz zu Ministerinnen oder Staatssekretären sind sie auch in ein paar Jahren noch da. Allerdings: Wohlerworbenes Anrecht auf Geld von der Allgemeinheit, das gibt es für Kulturinitiativen schlicht nicht. Alles hat immer wieder aufs Neue hinterfragt zu werden. Wer hier darauf aus ist, seine Anliegen auch direkt zu vertreten, verschafft sich leichter Gehör, Verständnis, FürsprecherInnen. Wobei sich die Beziehungspflege nicht darauf beschränken sollte, einmal im Jahr telefonisch oder per Mail nachzufragen, ob die Fördereinreichung eh eingelangt wäre. Nein, ich fordere hier nicht Verhaberung, sondern das Kultivieren einer Gesprächsbasis.
Urbanität in die Regionen
In einer ganz anderen Angelegenheit sind Kulturinitiativen übrigens klar Vorreiterinnen – daran musste ich unlängst beim Lesen eines Strategiepapiers des deutschen Zukunftsinstituts für den ländlichen Raum denken. Dass die Stadt künftig mehr denn je der dominierende Lebensraum sein wird, da sprechen ohnehin alle globale Studien eine klare Sprache. Das Zukunftsinstitut empfiehlt der Politik gar nicht erst zu versuchen, da ländliche Gegengewichte zu schaffen. Sondern:
«Man muss die Urbanität so weit es geht in die Regionen bringen. Dabei muss man sich fragen, in wie vielen und in welchen Regionen das überhaupt funktioniert und dann zum Beispiel kluge Achsen aufbauen, die Städte miteinander verbinden.»
Kulturinitiativen mit ihren stabilen – und vor allem gleichberechtigten – Beziehungen in urbane Räume haben hier wohl mehr denn je die Funktion, Lebensqualität zu gewährleisten und eine kulturelle Grundversorgung zu garantieren. Das Argument «Dort gibt es ja sonst nix!» dürfte – und sollte – dennoch an Bedeutung verlieren