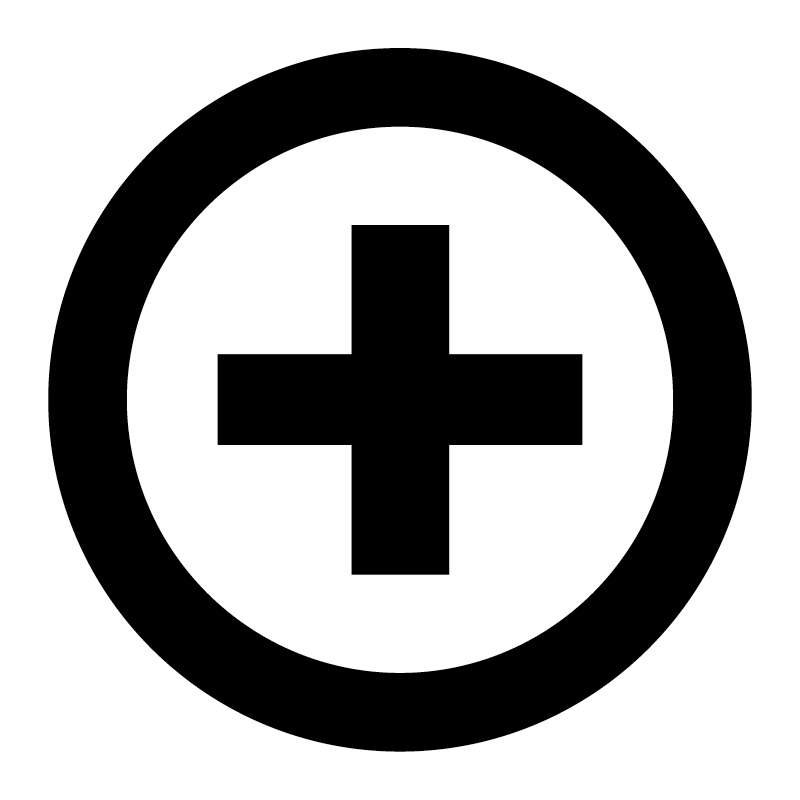Zwischen ORF-Gebühren, Presseförderung und Strukturkrise: Ist es nötig, Medien mit öffentlichen Geldern zu untersützen?
Ein europäisches, öffentlich-rechtliches Facebook
Als Christian Kern als neuer Bundeskanzler vor die Medien trat, wollten die ReporterInnen neben Details zu seinem New Deal auch mehr über die Zukunft ihrer eigenen Jobs wissen: Wolle Kern die Medienpolitik seines Vorgängers Werner Faymann weiterführen, also sich durch die kräftige finanzielle Unterstützung von Kronen Zeitung, Österreich und Heute weiterhin Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit erkaufen? Oder wolle sich der neue Kanzler endlich von der anzeigengestützten PR abwenden und die angestaubte Medienförderung reformieren. Dies würde in der Branche zu Umstrukturierungen und Jobverschiebungen führen. Schnell wurde klar, dass der Bundeskanzler und sein für Medien zuständiger Minister Thomas Drozda einen größeren Wurf planen: Sie sprachen davon, die Inseratenbudgets öffentlicher Stellen zu reduzieren und im gleichen Zug die Presseförderung zu erhöhen. In Zukunft könnten weniger die Medienunternehmen selbst, dafür mehr journalistische Qualität gefördert werden. Weniger bestellte Berichterstattung und mehr unabhängiger Journalismus also: Das ist vernünftig. Ob es sich realpolitisch umsetzen lässt, bleibt offen.

Das Ende des Wirtschaftsblatts und das angekündigte Sparpaket beim Kurier erinnern uns daran, dass selbst im “Krone”-Land Österreich die gedruckte Tageszeitung mittelfristig zum Minderheitenprodukt schrumpfen wird. Wollen wir den tagesaktuellen Journalismus erhalten, müssen wir ihn fördern – und zwar im Rundfunk- und Onlinebereich. Die Druckerpressen des Boulevards querzusubventionieren hilft außer den Dichands und Fellners dieser Welt niemandem. Stattdessen sollte die Regierung neben dem Qualitätsjournalismus auch kleine Medienorganisationen und Nischen stärker bei der Reform der Medienförderung berücksichtigen. Denn dort, an den interdisziplinären Schnittstellen, werden Themen aufgeworfen und passieren die Innovationen, von denen indirekt auch traditionelle Medienhäuser profitieren. Die Regierung muss auch über den Aufbau neuer Distributionsnetzwerke nachdenken: Facebook wird auf absehbare Zeit seine Vormachtstellung als Quasi-Monopolist für die Verbreitung digitaler Nachrichten kaum verlieren – außer die Politik interveniert auf europäischer Ebene. Der US-Konzern muss in Zukunft weniger dem Markt und mehr der Öffentlichkeit verpflichtet werden. Sollte diese Regulierung scheitern, müssen wir uns daran machen, eine europäische Facebook-Alternative zu gründen, getragen von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten.
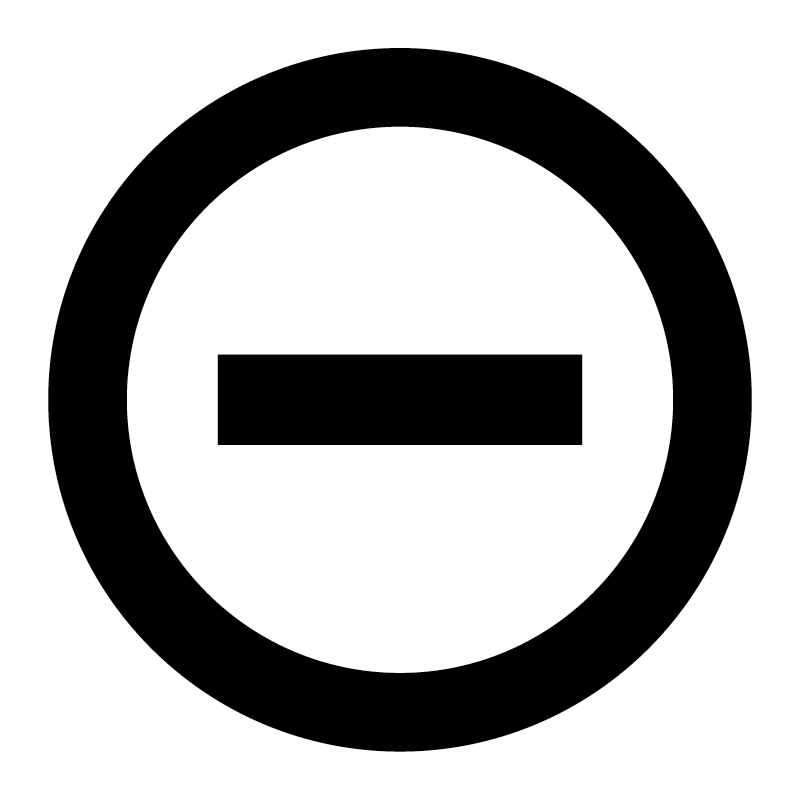 Die Zeit der staatlichen Medienhäuser ist vorbei
Die Zeit der staatlichen Medienhäuser ist vorbei
Analogien sind schwierig, aber Dinge zu vergleichen, bedeutet nicht, sie gleichzusetzen. Also fragen wir einmal: „Ist es nötig, Bäckereien mit öffentlichen Geldern zu unterstützen?“ Für so eine Idee wird es wohl durch die Bank keine Unterstützung geben. Es gibt genügend Bäckereien und Wettbewerb untereinander, um den Brotbedarf hinsichtlich Menge und Güte in der Bevölkerung zufrieden zu stellen. Wer auf Qualität keinen Wert legt, kann ja zum Diskonter gehen.
Dieses Prinzip auf Medien umzulegen, funktioniert nur bedingt. Aber die Annahme, dass ein privater, pluralistischer Medienmarkt, der die informative Grundversorgung (Qualität) der Bevölkerung mit der entsprechenden Reichweite (Quantität) gewährleistet, ohne die Steuerzahlerinnen zu belasten, den Idealzustand darstellt, wird wohl auf breite Zustimmung stoßen. Die gängige Hypothese in Österreich und vielen anderen Ländern ist allerdings, dass der Markt hier hinsichtlich Qualität versagt. Deswegen gibt es staatliche Medienhäuser, die maßgeblich über Gebühren finanziert werden. Und niemand weiß, ob ein Medienmarkt ohne staatliche Intervention seine Versorgungsfunktion besser, gleich gut oder schlechter erfüllt. Ja, man darf sogar der Meinung sein, dass das eine unerhebliche Frage ist.

Nehmen wir aber einmal als Prämisse an, dass der Markt für eine Demokratie notwendige Inhalte, nennen wir sie Public Value, die zu einem ausgewogenen Diskursniveau führen, nicht ohne öffentliche Gelder herstellen kann. Dann bleibt noch die Frage offen, ob der Markt auch bei der Verbreitung versagt. Und hier können wir mit Sicherheit feststellen, dass das nicht der Fall ist. Wenn etwas dank Digitalisierung und Vernetzung funktioniert, dann ist es die Verbreitung von Inhalten durch private Medien. Das heißt aber auch, dass jede Form – immer unter obiger Prämisse – der Förderung hin zu einer Public-Value-Inhalteförderung angepasst werden muss. Konkrete Konsequenz wäre es also, keine staatlichen Medienhäuser zu betreiben, sondern Journalismus zu unterstützen, egal wo dieser stattfindet. Das bedeutet kein Ende des ORF (oder der Wiener Zeitung), sondern einen Umbau zu ebendieser Funktion. Von dieser Ausgangsbasis können wir, ohne Produktion von Public Value zu riskieren, testen, ob die obige Prämisse dann überhaupt noch notwendig ist.