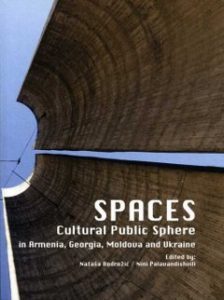Martin Wassermair über aktuelle Kulturpolitik und mögliche Auswege.
Am Abend der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen 2001 wurde der zu diesem Zeitpunktamtierende Kunstsektionsleiter in einem privaten Gespräch gefragt, wie er, der nur ungern gelittene Oppositionelle im damals rechts-konservativ geführten Bundeskanzleramt, seine Rolle anzulegen gedenke, sollte ihm eines Tages eine kulturpolitische Regierungsfunktion übertragen werden. Andreas Mailath-Pokorny zögerte nicht eine Sekunde. Als Kulturpolitiker, so die prompte Antwort des hochrangigen Beamten, würde er auch in Österreich den allgemeinen Stellenwert eines Jack Lang einnehmen, jederzeit unerschrocken aufstehen und womöglich als erster die mahnende Stimme der Staatsführung erheben, falls eine Bedrohung der demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft dies erfordere.
Seit nunmehr 14 Jahren bekleidet der gleiche Andreas Mailath-Pokorny das Amt des Wiener Kulturstadtrats. Es ist nicht bekannt, ob Jack Lang jemals von ihm oder einem öffentlichen Fingerzeig Notiz genommen hat. Nicht weniger fraglich bleibt, inwieweit der langjährige französische Kultur- und Bildungsminister überhaupt noch Kulturpolitiken zu identifizieren vermag, die sich angesichts der ökonomischen und sozialen Verwerfungen unserer Zeit progressive Geltung zu verschaffen wissen. Stattdessen wird seit Jahrzehnten lediglich verwaltet. Kunst und Kultur sind auch in Österreich bestenfalls noch dem Optimierungswahn eines behördlichen Facility Managements überlassen, vorrangig zum politischen Zwecke der medialen Selbstdarstellung und einer auf Tradition und Brauchtum bedachten Besitzstandswahrung. Mit der damit geschaffenen Leere in Vision und Programmatik hat sich allerdings auch hierzulande die Kulturpolitik vor dem Tabernakel von Kapitalismus und neoliberaler Zerstörungswut am Gemeinwesen selbst enthauptet. Entfesselte Finanzmärkte, supranationale Medienmonopole, massenhafte Verelendung und profitgierige Kriegstreiberei sitzen – so scheint es gegenwärtig – alternativlos fest am Thron.
Somit ist es nur folgerichtig, dass sich auch die KUPF Anfang Juni in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung auf die «Suche nach einer oberösterreichischen Kulturpolitik» begab. Doch wer auf eine Auferstehung hoffte, wurde jäh enttäuscht – denn kulturpolitische Positionen, die sich durch gesellschaftliche Zusammenhänge begründen ließen, nahmen mit den vertretenen Kultursprecherinnen von ÖVP, SPÖ und Grüne am Podium nicht Platz. Es darf also keineswegs verwundern, wenn durch kulturpolitische Leerstands-Shows der rechtsextreme Pöbel auf ein Territorium stürmt, auf dem eigentlich die Fahnen universell gültiger Prinzipien wie Solidarität, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit wehen sollten.
Nun aber reklamiert die FPÖ auf Wahlplakaten ihre Alleinherrschaft über «unsere Werte und Kultur» und schneidet immer tiefer in das Fleisch der kulturpolitischen Versäumnisse. Plötzlich wird der Kulturbegriff zu einer Kriegserklärung, manifestiert sich als politisches Programm und greift mit zunehmendem Erfolg nach der Stimmenmehrheit. Diesem Feldzug gegen Menschen auf der Flucht, gegen Pluralismus, sozial Schwache und Andersdenkende, ist nicht durch zahnlose Parolen wie «Kultur für alle» oder gar «Kultur kostet Geld, Unkultur kostet noch viel mehr» beizukommen. Es ist die enge Verbindung des Identitären mit Demokratieabbau und globaler Unterdrückung, die es mit allem Nachdruck zu bekämpfen gilt. Von Kulturpolitik, wie sie die nostalgische Retrospektive vielleicht noch in Ehren hält, ist nichts mehr zu erwarten. Neue Ideen von Kultur könnten hingegen wieder politische Kraft entfalten, wenn sie dem unansehnlichen Erbe der Post-Kulturpolitik den Kniefall verweigern – durch Widerborstigkeit, Integrationsunwillen und dem festen Glauben an das gute Leben.