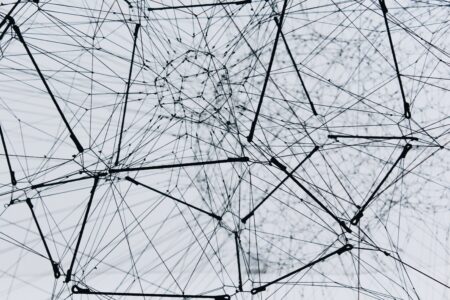Der westliche Zugang zu China hat sich trotz Informationstechnik und Wirtschaftsbeziehungen kaum verändert. Immer noch ist es der exotische Riese, von dessen Kultur man träumen und an dessen Schätzen man reich werden kann. Andreas Kurz berichtet für die KUPFzeitung aus Shanghai.
Atemlos kam ich, nach meinem zweiten Arbeitstag, aus der U-Bahnstation Zhongshan Bei Lu. Schon beim Rolltreppefahren hatten mir Rauch und Kohlestaub die Luft genommen, nun stand ich, direkt am Ausgang, einer Verkäuferin gegenüber, die eine kleine Maronibraterei betrieb: Eine Halbschale voll schwarzer Steinchen, in denen, von einem Kohleofen unterfeuert, Kastanien rösteten. Ich beobachtete die Verkäuferin, wie sie Steinchen und Maronen mit einer langstieligen Kelle umwand, die verbrannten Maronen herausgriff und in einen Plastikkübel warf. Der war schon zur Hälfte mit verkohltem Abfall gefüllt; die arme Frau schien mehr wegzuwerfen als zu verkaufen. Auch am nächsten Tag stand sie da, schaufelte in ihrer Bratschale herum und schmiss verbrannte Kastanien weg. Ich kaufte ein Stanizel, es kostete acht Yuan. Am dritten Tag hatte sich ein weiterer Maronibrater danebengestellt, auch er machte kaum Geschäft, übers Wochenende kam ein dritter hinzu, und bald waren sie zu fünft. Ich ging täglich an ihnen vorbei, sah, dass sich mehr und mehr Kunden fanden, kaufte nochmals eine Portion, diesmal kostete sie sechs Yuan, Konkurrenz drückt eben auf den Preis. Die Käufer wurden zahlreicher, ebenso aber die Verkäufer, bald gab es Würstchengriller, Nudelkocher, Spießchenbrater, die Maronen kosteten nur noch drei Yuan, und in meinem Stanizel fanden sich nun auch die verkohlten. So ging es weiter, ein kleiner Markt entstand und ruinierte sich umgehend selbst, denn je stärker ein bestimmtes Produkt vertreten war, desto mehr Verkäufer versuchten ihr Glück mit genau derselben Ware. Da fielen zuerst die Preise, dann die Qualität und das so lang, bis sich die Verkäufer das Verkaufen nicht mehr leisten konnten. Als meine dritte Arbeitswoche begann, waren sie alle weg, auch der Rauch war fort und der Vorplatz leer.
Die Maronibrater-Episode war einer meiner ersten Eindrücke von Shanghai und schien das Klischee von der Imitationskultur Chinas zu bestätigen: Wo viele Leute sind, muss es gut sein, sonst wären dort nicht so viele Leute; was viele Leute tun und haben, muss richtig sein, sonst täten und hätten es nicht so viele.
Tatsache ist, dass die Städte Chinas in unkontrollierbarem Ausmaß wachsen und heute niemand sagen kann, wie hoch beispielsweise die Einwohnerzahl Shanghais tatsächlich ist. Offiziell spricht man von 23 Millionen Menschen, Schätzungen aber belaufen sich, Wander- und Saisonarbeiter mit eingerechnet, auf 25, manche auf 30 Millionen. Europäische Wirtschaftsberater empfehlen ihren Klienten längst von Shanghai abzusehen und Firmenniederlassungen besser in Shenzhen, Guangzhou oder Chongqing anzusiedeln, Agglomerationen, die auch schon 13, 16 und 28 Millionen Einwohner haben, in denen der Zyklus von Zuwachs, Konkurrenzdruck und Absterben aber erst beim dritten Maronibrater angelangt zu sein scheint.
Über China
Man sollte jedem, der etwas über China erklärt, misstrauen. Auch mir. Was ich zu Shanghai äußern kann, sind Vermutungen. Was ich über China sage, ist Phantasie. Und ich befinde mich damit in bester Gesellschaft, oder in schlechtester, jedenfalls aber in größter. Kaum jemand weiß wirklich etwas über dieses Land, das als solches überhaupt nicht erfasst werden kann und dessen Gesellschaft keine ist. Die Bevölkerung wird durch ein gemeinsames Territorialgebiet zusammengehalten, durch eine gemeinsame Währung und – bedingt – durch Regierungsgewalt, durch sonst nichts. Es gibt die Familie, darüber hinaus fühlt sich der Chinese für niemanden verantwortlich. Es gibt die Uiguren im Westen: turkstämmige Muslime, die Mandarin (Hochchinesisch) nicht beherrschen und arabische Schrift verwenden. Es gibt die Mongolen im Norden und die Tibeter im Süden, insgesamt besteht die Bevölkerung Chinas aus 90 verschiedenen ethnischen Gruppen. In China ist alles anders als in Europa, habe ich oft sagen hören. Aber ich glaube, in China ist auch immer alles anders ist als in China.
Wie groß die innere Heterogenität des Landes auch sein mag, sie ist harmlos im Vergleich zur Tranchierung von außen. Wenn wir Europäer von China sprechen, meinen wir den südwestlichen Landesteil und damit kaum zwanzig Prozent des Staates. Wenn in Wien, Berlin oder sonstwo für die Freiheit Tibets protestiert wird, dürfte wenigen Demonstrierenden bewusst sein, dass das Tibetische Hochland ein Drittel des Landes ausmacht, alle großen Flüsse Chinas dort entspringen und eine Freigabe dieses gewaltigen Landstrichs den Ruin des Landes bedeuten würde. Und wenn man mit Politikern (Hobby- oder Berufs-) über China spricht, begegnet man überhaupt den allerabenteuerlichsten Phantasien und Argumenten, die schon auf den zweiten Blick nichts mehr mit China und seiner Politik zu tun haben.
Seit Franz Grillparzer 1839 seinen satirischen Bericht Neueste Nachrichten aus Cochin-China geschrieben hat (in dem es um die österreich-ungarische Verwaltung geht), seit Franz Kafka seine China-Texte verfasste, seit Hermann Knackfuß sein Lithografie Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter vollendete (besser bekannt als Die gelbe Gefahr), hat sich, wie mir scheint, nicht allzuviel am europäischen Umgang mit China verändert: Europäisches und amerikanisches Wirtschaften in China basiert auf uralten Macht-, Eroberungs- und Reichtumsphantasien, und wenn darüber gesprochen wird, dass China den Westen bald überholen könnte, müsste man eigentlich sagen, dass sich der Westen in China bald selbst überholt. Auch der Protest europäischer Liberaler ist eine Art Exterritorialisierung, im Zuge derer China als Theaterbühne verwendet wird, um eigene Stücke zu spielen, und ich habe den Eindruck, es geht praktisch nie um Tibet, oder um Menschenrechte, sondern um das diffuse Gefühl des eigenen Benachteiligt- und Unterdrücktwerdens, nur dass für andere, 11.000 km Entfernte zu sprechen einfacher und konsequenzloser ist, als für sich selbst. China war und ist eine Projektionsfläche eigener Hoffnungen und Ängste und eine Metapher für das Fremde, Mystische, Geheimnisvolle.
Westliche Bilder
Geheimnisvoll ist es ja auch zweifellos, wenn man frühmorgens oder spätabends in Shanghai unterwegs ist und auf Plätzen, Gehsteigen oder in kleinen Parks all die Baumstreichler, Rückwärtsgeher und Schriftzeichenschreiber sieht, die Qi-Gong-, Tai-Chi- oder Schwertkampf-Meditierer und die vielen Frauengruppen, die in strenger Quadratformation zu Britney Spears oder Beyoncé gymnastikartige Tänze aufführen. Geheimnisvoll auch die Ordnung im chaotischen Straßenverkehr, fremd die Nähe zum Boden, auf dem gehockt, gearbeitet, gespielt, telefoniert, Geld gezählt wird, fremd und großartig vor allem das Essen, unbekannt die Hälfte des Gemüses am Markt, der Reichtum an Zubereitungsarten und Geschmäckern, befremdlich die völlige Respektlosigkeit vor Menschen aus niedrigerem sozialen Stand, die Geringschätzung von Untergebenen, Tieren und – sowieso – von Gegenständen: Wartung oder Instandhaltung gibt es nicht. Einem Europäer (genauso wie einem Amerikaner, Australier, Westasiaten etc.) kommen hier die Maßstäbe abhanden und schnell ist man mit Urteilen und Kategorisierungen zur Hand, auch aus der Notwendigkeit heraus, sich zu alldem irgendwie ins Verhältnis zu setzen.
Eines der ersten Urteile, die ich über meine neue Arbeitsumgebung gefällt habe, war: Shanghai ist keine Stadt. Denn für mich definiert sich eine Stadt, gut alt europäisch, über Begriffe wie Bürgertum, Intellektualität, Handel oder Geschichte. Shanghai aber – hauptsächlich bevölkert von migrierten Bauern, einfachen Handwerkern, Wanderarbeitern und Analphabeten, dominiert von Schnellreichgewordenen, erbaut in kostenreduzierten Gewaltakten – handelt nicht, sondern rafft, pulsiert nicht, sondern wird von außen zwangsstimuliert, und ein Shanghaier Bürgertum ist, auch aus geschichtlichen Gründen, inexistent. Ich bekomme diese Stadt nicht anders zu fassen als durch Bilder und Vergleiche, beispielsweise durch die Vorstellung, man habe hier dreieinhalbtausend Mal meinen Heimatort Attnang-Puchheim übereinandergestapelt: Auch daraus würde noch lang keine Stadt resultieren, wohl aber hochverdichtetes Nebenleben ausgemachter Nichtstädter, ein behelfsmäßiges Sichorganisieren und ein Irgendwiezurechtkommen ohne kulturelle Eigenständigkeit, ohne Intellektualität, ohne Gewachsenheit; die kleinstädtische Gemächlichkeit Attnang-Puchheims wäre dahin, ein städtisches Leben, wie man es aus London, Berlin oder Paris kennt, trotzdem unmöglich. Und obwohl dieses Bild völlig schief, weil völlig europäisch ist, bin ich überzeugt, dass es nicht schiefer und europäischer sein kann als andere Erklärungsmodelle, die man gemeinhin zu China präsentiert bekommt.