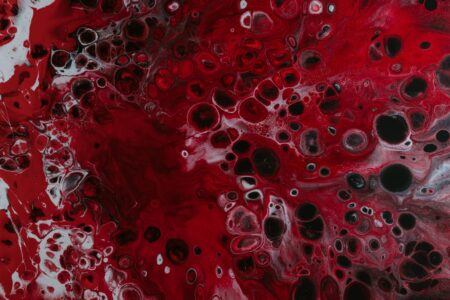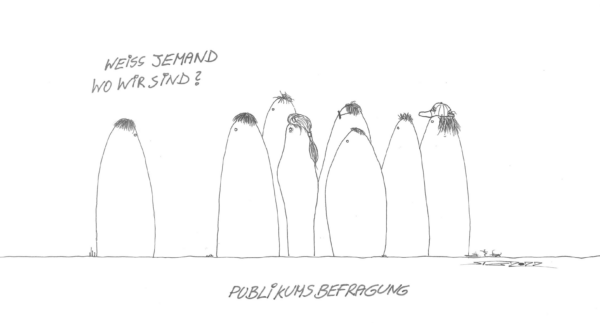Am 14. Mai fand im Linzer Wissensturm der zweite Open Commons Kongress der Open Commons Region Linz & Upper Austria statt. Dazu hatten sich die Veranstalter nationale und internationale Vortragende eingeladen, um über (Open) Commons im Umfeld von Bildung & Wissenschaft, Wirtschaft & Verwaltung sowie Gesellschaft & Kultur zu diskutieren. Die Keynote kam von Silke Helfrich, Mitbegründerin der Commons Strategies Group, die im Anschluss an ihren Vortrag Wolfgang Gumpelmaier in einem Interview Rede und Antwort stand.
Wolfgang Gumpelmaier: Sie haben in Ihrer Keynote über den Begriff der «Commons» gesprochen. Was verstehen Sie darunter?
Silke Helfrich: Es gibt Dinge im Leben, die wir teilen müssen, weil sie notwendig sind für uns alle, für die Reproduktion unseres Lebens. Und zwar einfach deshalb, weil wir nicht alleine auf dieser Welt sind. Das sind natürliche Ressourcen wie Wasser oder Land. Es gibt aber auch Dinge, die wir teilen sollten.
Und zwar einfach deshalb, weil sie immer mehr werden, wenn wir sie teilen: Wissen, Information, Code. Alles das erschließt sich erst dann in seiner Fülle und Vielfalt, wenn wir es nicht wegschließen oder mit individuellen Eigentumsrechten belegen. Wenn wir Wissen teilen, haben alle mehr davon.
In den Commons ist die Idee des Teilens gekoppelt an die Idee der gemeinsamen Produktion und des gemeinschaftlichen Sorgetragens für das, was geteilt wird. Die Idee, dass ich fairen Zugang habe, zu dem was ich im Leben brauche, sei es Wasser, Land, Wissen oder Software, ist gekoppelt an die Frage «Wie stellen wir das gemeinsam her? Wie können wir etwas uns Gemeinsames so pflegen und reproduzieren, dass es auch morgen noch da ist?» Dieser Gedanke bündelt sich im Begriff der Commons.
Diese Idee der Commons, vor allem mit dem Zusatz «Open», kennt man vorrangig aus Bereichen der Software (Open Source), der Wissenschaft (Open Science) oder des Datenzugangs (Open Data). Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, bzw. dem Zugang zu Lebensmitteln, Energie, Wasser, wird Commons noch sehr selten erwähnt, oder?
Im Grunde ist es genau umgekehrt. Commons, wenn wir darunter das gemeinschaftliche Sorgetragen und Pflegen von natürlichen Ressourcen verstehen, sind so alt wie die Menschheit. Schon in der Steinzeit konnte kein Mensch ein Mammut alleine er- und zerlegen und dafür sorgen, dass es konserviert wird.
Das musste immer gemeinsam geschehen. Commons, als gemeinsame Praxis verstanden, hat es schon immer gegeben.
Eine andere Frage ist, ob es dafür einen Begriff gegeben hat. In der Steinzeit vermutlich nicht, aber auch der Commons-Begriff ist schon sehr alt. Er hat eine etwa tausendjährige Geschichte und bezeichnet
eigentlich eine mittelalterliche Eigentumsform. Es ist jedoch nicht einfach, den Begriff und die Idee dahinter in die Jetzt-Zeit zu holen und ihr diesen rückwärtsgewandten Hang zu nehmen. Das ist eine Aufgabe, der sich jede Gesellschaft neu stellen muss.
Es gibt innerhalb der Commons-Debatte ver-schiedene Konzepte und Zugänge. In Ihrem Vortrag haben Sie erwähnt, dass unter anderem in diesem Zusammendenken der beiden Strömungen (Anm. d. Red.: Lessig vs. Ostrom), die große Herausforderung besteht. Wie kann man das erreichen?
Ich skizziere zuerst kurz diese unterschiedlichen Zugänge. Wenn wir sagen, im Kern des Commons-Begriffs stehen zu teilende Dinge oder Güter, dann stellt sich die Frage «Welche sind das?». Bezogen auf den Umgang mit natürlichen Ressourcen hat sich ein ganzer Wissenschaftszweig etabliert, der sehr interdisziplinär arbeitet. Aber er ist konzentriert auf Ressourcen, denen eine Endlichkeit innewohnt, die also weniger werden, wenn wir sie teilen, zum Beispiel Land oder Wasser.
Mit der Digitalisierung der Gesellschaft hat sich aber auch eine andere Forschungsrichtung etabliert. Sie hat eine interessante Parallele festgestellt: So wie die Menschen früher durch das Einzäunen von Land von dessen gemeinschaftlicher Nutzung getrennt wurden, wird heute unser Wissen eingezäunt.
Beiden Richtungen forschen (mit Ausnahmen) relativ intensiv nebeneinander her. Dabei erhält die Commons-Idee aus meiner Sicht aber erst dann eine wirklich transformatorische Perspektive, wenn wir begreifen, dass beides zusammengehört. Also auf der einen Seite begrenzter Zugang zu natürlichen Ressourcen und auf der anderen Seite offener, freier Zugang zu im-materiellen Ressourcen wie Wissen, Code und Software. Dabei geht es zentral immer um die Punkte Fairness und Freiheit durch das gemeinschaftliche Herstellen, Pflegen und Nutzen. Man könnte das auch Freiheit in Verbundenheit nennen.
Das klingt wie eine schöne Vision, fast schon wie eine Utopie. In der Realität benötigt man aber vor allem Geld, um überleben zu können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es auch in den Commons nicht darum, dass alles kostenlos ist. Kann man sich dennoch auch mit Commons-«Produkten» sein Leben sichern und wie funktioniert das?
Wenn wir Commons in einer Gesellschaft denken, die komplett markt- und gelddominiert ist, dann kommen wir an der Frage nicht vorbei, wie wir mit den Schnittstellen umgehen. In der Regel schöpft ja der Markt aus den Commons (das reicht bis zur Plünderung) und gibt nichts in sie zurück. Es ist also wichtig, dass Commons vor diesen Übergriffen des Marktes geschützt werden. Solange wir Commons als Keimformen des Neuen in der Marktgesellschaft entwickeln, solange werden wir etwa die Frage beantworten müssen, wie man Commons-Projekte und -Initiativen zumindest finanziell so absichern kann, dass sie überlebensfähig sind. Und zwar möglichst so, dass sich nicht die Marktlogik einschleicht. Und dafür muss man das Geben vom Nehmen in Zeit und Dimension entkoppeln. Also: Ich kriege für meine Gabe nicht gleich, und auch nicht unbedingt das Gleiche (Äquivalente) zurück, aber ich weiß, dass ich vom Common etwas habe, sobald ich das brauche. Geld spielt also in den Commons eine Rolle, darf aber nicht – so wie auf dem Markt – die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen strukturieren, beziehungsweise dominieren.
Gerade bei Facebook & Co wird ja immer auch vom Teilen gesprochen, Stichwort: Shareconomy. Welche Rolle spielen im Zusammenhang mit Commons die «Sozialen Medien»?
Facebook oder Google sind nicht mit Commons zu verwechseln. Diese Dienste ermöglichen Open Access, also freien Zugang. Commons sind aber nicht dasselbe wie Open Access, auch wenn das in einigen Commons (z. B. Wikipedia) eine große Rolle spielt. Die entscheidende Frage ist: Wer kontrolliert die Zugangs- und Nutzungsbedingungen? Bei Facebook & Co sind das Konzerne. Wenn sie etwas ändern wollen, haben sie die Macht dazu. So wie sie die Macht haben, uns zu kontrollieren. Und wenn sie den Bach runtergehen, sind unsere Daten und Inhalte (und die darin geronnene Arbeit) mitgehangen und mitgefangen.
Die Monopolisierung von Kontrolle ist schlicht nicht Commons-affin. Commons heißt soziale Kontrolle und gemeinschaftliche Re/Produktion. Und hier liegt ein enormes Potenzial der neuen Kommunikations- und Informationstechnologien. Sie erlauben uns, sehr komplexe Dinge in globalen Netzwerken zu schaffen.
Wie die Wikipedia…?
Genau. Die war mit den Technologien der 60er Jahre noch nicht denkbar. Wenn Commons traditionell gedacht werden, also als gemeinschaftliches Sorgetragen für natürliche Ressourcen, dann beziehen wir uns in der Regel auf kleine, überschaubare Gemeinschaften. Viele können sich Commons vorstellen für eine afrikanische Dorfgemeinschaft, die gemeinsam ihren Brunnen pflegt, aber nicht für große, unüberschaubare Gruppen oder internationale Netzwerke. Die neuen IKT bieten nun die Chance, Commons auf einen höheren Maßstab zu heben. Sie können in die Breite wachsen – in jede Richtung.
Der Klassiker ist die freie Softwarebewegung. Hier wird ein Software-Commons gemeinsam von einem weltweiten Netzwerk gepflegt. Und wir alle können es nutzen. Das ist auch für die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wichtig, denn ich glaube, dass jedes Commons ein Wissenscommons ist. Ich halte die klassische Unterscheidung zwischen natürlichen Commons und Wissenscommons für ein bisschen überholt. Das eine hängt mit dem anderen schließlich ganz eng zusammen. So ist die Frage, wie wir unser Saatgut fortentwickeln, eine Frage des Wissensmanagements. Nehmen wir das System for Rice Intensification, das in Madagaskar
vor einem halben Jahrhundert seinen Anfang nahm und insbesondere seit Beginn der Neunziger (Internet!) immer mehr in Asien zur Anwendung kam. Inzwischen wird es von 4–5 Millionen Bauern in 40 Ländern genutzt. Hier können die Züchter und Bauern die jeweiligen Sorten, Züchtungstechniken und -ergebnisse in einem globalen Netzwerk miteinander teilen. Die Ertragsverbesserungen sind enorm, die Fortentwicklung angepasster Sorten entscheidend. Das macht die Bauern unabhängiger vom Markt. Wissen kann man heute viel einfacher global teilen als es je in der Geschichte der Menschheit möglich war. Das sollten wir nutzen.
Die Commons-Theorie besagt: je mehr von unten getragen, umso besser. Das Interessante an der Open Commons Region Linz ist aber nun, dass sie aus der Verwaltung heraus passiert und nicht bottom-up, bzw. von den Bürgern. Wenn man das global denkt, wäre es dann nicht einfacher, wenn Commons top-down organisiert werden würden?
Idealerweise wäre es eine Aufeinanderzubewegung. Wenn eine Initiative von oben gestartet wird, die von den Menschen nicht getragen wird, nützt das nichts. Aber meistens ist das Problem ja umgekehrt. Gesetze, Infrastrukturen und (globale) Machtverhältnisse verhindern commoning. Elinor Ostrom, die berühmteste Commons-Forscherin der Welt, hat 2009 als erste Frau den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Sie hatte so genannte «Designprinzipien» für erfolgreiches Management kollektiver Ressourcen erfasst. Eines dieser Prinzipien sagt, dass das Recht, Dinge selbst zu verwalten, gemeinsam Regeln aufzustellen und durchzusetzen vom Staat, bzw. der nächst höheren Autorität anerkannt werden muss. Damit also etwas gelingen und von den NutzerInnen getragen werden kann, ist es wichtig, dass der Staat dem nicht im Weg steht. Eine Bedingung für gelingendes Commons-Management ist demnach, dass der Staat Selbstorganisation nicht torpediert. Wenn wir darüber hinaus eine Situation haben, in der der Staat selbst begreift, welche Stabilisierungsfunktion in Commons liegt und dies aktiv unterstützt, umso besser.
Aber erstmal zeigt die Forschung, dass das, was von unten nach oben wächst, nachhaltiger ist. Denn dadurch gelingt es Menschen, sich mit diesem Gemeinsamen zu identifizieren.
In diesem Sinne ist die Open Commons Region also ein spannendes Pilotprojekt, in dem die Mischung, die Aufeinanderzubewegung ja ganz gut funktioniert. Ich denke, wir beide freuen uns auf weitere ähnliche Initiativen.
Herzlichen Dank für das Interview!
Danke ebenfalls.
Eine Langversion des Gesprächs ist hier zu lesen:
Silke Helfrich ist als freie Autorin und Commons-Aktivistin in Europa und darüber hinaus unterwegs. Von 1999 bis 2007 Leitung des Regionalbüros der Heinrich Böll Stiftung für Mittelamerika, Mexiko, Kuba.
→ commonsblog.de