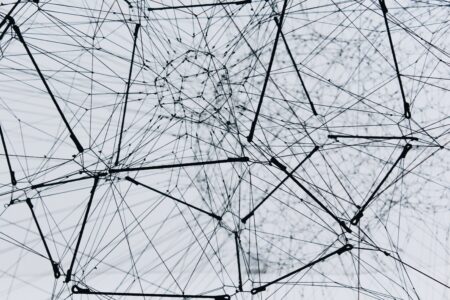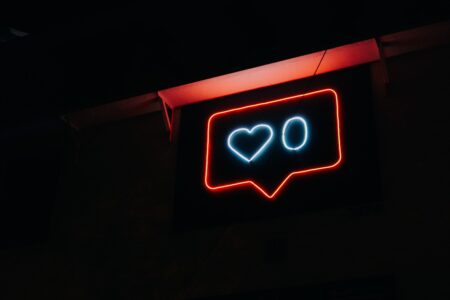Otto Tremetzberger hat den „Kulturinfarkt“ gelesen.
Infarkte kommen nicht aus heiterem Himmel. Schmerzen, Lähmungen, Schweißausbrüche. Und damit es überhaupt erst dazu kommt: Stress, falsche Ernährung, Bewegungsmangel. Das Ende: „Blutstau“ und schließlich der „pathologische Untergang einzelner oder mehrerer Zellen“[1]. So, oder so ähnlich, steht es auch um den Kulturbetrieb, glaubt man Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz und Dieter Haselbach und ihrer Polemik vom „Kulturinfarkt“[2]. Was die Gesellschaft gesund machen sollte liegt selbst darnieder.“ Im Angesicht der „Krise“ sind die fetten Jahre vorbei. Kulturbudgets stagnieren. Aufmerksamkeit, öffentliche und politische Wertschätzung für kulturelle Belange brechen ein. Schwerfällige kulturelle „Leuchttürme“ verschlingen „den Löwenanteil der Kulturhaushalte“ und sind außerdem nicht bereit oder einfach unfähig, andere als die traditionellen Bildungsbürger zu erschließen. Migration, globaler Austausch, Medienrevolutionen haben zwar den Alltag verändert: „aber nicht den Kulturbetrieb“. Ein System steht vor dem Zusammenbruch. Die Radikalkur: Halbierung der etablierten (meist hochkulturellen) Infrastrukturen.
Die hier tendenziös verkürzte Diagnose trifft wunde Punkte. Zum Beispiel das Unbehagen vieler vor allem kleiner, kritischer Initiativen und Gruppen, zunehmend unter die Räder zu kommen. Die Autoren haben in grober Absicht eine Verteilungsdebatte angefacht. Entsprechend stürmisch und ablehnend sind die Reaktionen. „Der Infarktimpuls hat zu einer neuen Aufmerksamkeit für kulturpolitisches Denken und Handeln geführt“[3] , schreiben Oliver Scheytt und Norbert Sievers. Gemeint ist Deutschland. Diejenigen nämlich, die hierzulande die Botschaft potentiell betreffen könnte, haben „nicht einmal mit der Wimper gezuckt“ (Michael Wimmer).[4] Auf die Frage, ob sie denn der „Kulturinfarkt-Analyse“ etwas (also zumindest nicht Nichts) abgewinnen könne, entgegnete Stefanie Carp, Schauspieldirektorin der Wiener Festwochen, lapidar mit „Nein, ich halte es für reaktionäre Effekthascherei“[5].
Kritik an der Hochkultur findet man in Österreich hauptsächlich in sozialdemokratischen Geschichtsbüchern als in der zeitgenössischen Kulturpolitik. Martin Fritz ortet im Fahrwasser des Kulturinfarkts zwar schon die Vorzeichen „anbrechender Verteilungskonflikte“ und ahnt zu Recht, dass es „der Flotte der Hochkulturgegner_innen“ nicht immer leicht fallen wird, „zwischen der ignoranten Skylla der Kunstfeinde und (…) neoliberalen Sparefrohs zu navigieren.“[6] Allerdings, die hiesige Subkultur setzt sowieso auf Kooperation und Empathie statt auf Konfrontation. Just in der Zeitschrift der oberösterreichischen Kommunisten spricht ein „Kulturarbeiter“ vom „Phänomen, dass institutionalisierte Kulturbetriebe (…) mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wie die freie Szene. Massive Budgetprobleme, daraus folgender Personalnotstand bis hin zu Entlassungen. Möglicherweise sollte man Überlegungen anstellen, zukünftige Proteste hier zu koordinieren.“[7] Auch der KUPF steigt „der Gitzi auf“ wenn die von „Budgetproblemen“ gebeutelten „Kulturhäuser“ mit „unappetitlichen Praktiken“ die „bestmögliche Ausbeutung“ ihrer Beschäftigten („Working Poor“) vorantreiben. [8] Es ist hoffentlich nicht ganz ohne Ironie, wenn die Interessensvertretung der freien Kulturinitiativen (die vermutlich die meisten ihrer Mitarbeiter überhaupt nicht bezahlen können) für bessere Arbeitsbedingungen (mehr Förderungen?) in den „Leuchttürmen“ eintritt.
Freilich. Die Autoren des „Kulturinfarkts“ sind keine Lobbyisten der „Freien Szene“. Jene „Einrichtungen des Dritten Sektors“, die „aus der Kritik der Staatsinstitutionen“ entstanden sind, würden nämlich mittlerweile selbst nach dem „öffentlichen Dienst“ streben. Dies und vielleicht auch eine Neigung zur Fundamentalopposition sind wohl der Grund, warum der „Dritte Sektor“ den aufgelegten Elfmeter ins Tor des „geförderten Establishments“ nicht ausführt. „Zu wenig differenziert“, urteilt Elisabeth Mayerhofer, strategisch-politische Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich und entlarvt die Kritik der Autoren an einem elitären Kunstbegriff selbst als elitär: „Mit ein wenig mehr Sorgfalt und Differenziertheit hätte der „Kulturinfarkt“ vom Rundumschlag zur ernst zu nehmenden Kritik werden können.“[9]
In der Zwischenzeit fordert die „Halbierung der Infrastruktur“ schon erste Opfer. Der KUPF Innovationstopf wird bekanntlich biennal ausgerichtet. Und in Wien wurde beispielsweise die Förderung für das (ÖVP)-„Stadtfest“ um genau die Hälfte gestrichen. Damit soll ein neuer Event finanziert werden. Die Reaktion: „ein Armutszeugnis für die Stadt“[10] . Es ist mir nicht bekannt, ob private Sponsoren eingesprungen sind.
[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Nekrose
[2] Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel, Stephan Opitz (2012): Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Knaus.
[3] http://kupoge.wordpress.com/2012/03/22/der-kulturinfarkt-eine-kontraindikation/
[4] http://www.educult.at/blog/der-ritt-der-vier-kulturapokalyptiker-uber-die-deutsche-kulturlandschaft/
[5] http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kulturpolitik/454034_Theater-ist-wieder-politischer.html
[6] http://www.artmagazine.cc/content61499.html
[7] http://members.aon.at/libib/cafe38.pdf (Seite 12)
[8] https://kupf.at/zeitung/141/gnackwatsch-n
[9] http://igkultur.at/kulturpolitik/kommentare/kulturinfakt-eine-erregung
[10] http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/755189/Stadtfest_Der-Rest-vom-grossen-Fest?from=suche.intern.portal