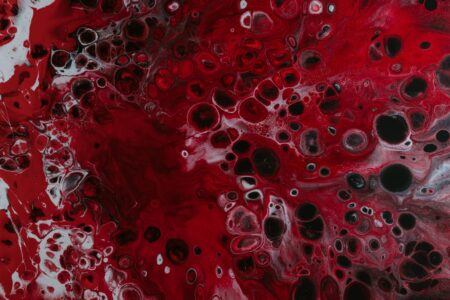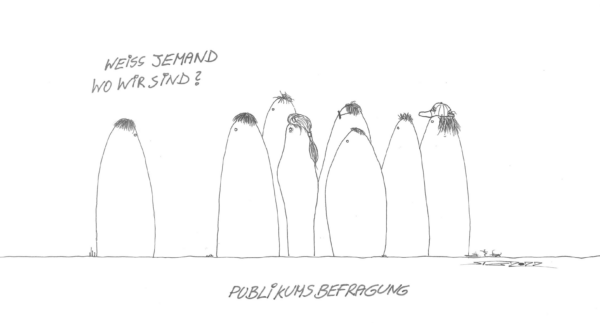Was gilt als politische Kunst und wer bestimmt das? Ein Gespräch mit Johanna Schaffer
Wir machen Kunst, weil es die feministische, gesellschaftliche, politische, meine Situation erfordert.
Das war der Titel einer Ausstellung von und mit Student_innen der Kunstuniversität Linz im Juni 2007 im Schirmmacher in Linz (im Aufbau dazu ist www.machenkunstweil.ufg.ac.at). Die Erarbeitung der Ausstellung wurde (mit Unterstützung von Barbara Paul und Karina Koller) von Johanna Schaffer angeleitet, die für zwei Jahre mit einer halben Assistenzstelle in der wissenschaftlichen Abteilung Kunstgeschichte, Kunsttheorie / Schwerpunkt Gender Studies an der Kunstuniversität Linz arbeitet. Die KUPF lud sie zu einem Interview über die Frage politischer Kunst im (starren?) Unibetrieb, J. Schaffer schlug stattdessen ein kurzes Gespräch zwischen ihr und Stefanie Seibold vor, weil sie das Gespräch zwischen einer primär wissenschaftlich-künstlerisch und einer primär wissenschaftlich-theoretisch Lehrenden interessiert. Stefanie Seibold unterrichtet seit mehreren Jahren als externe Lehrbeauftragte (d. h. mit freiem Werkvertrag, der jedes Semester neu ausgestellt wird) an der Kunstuniversität; Zeichnen im Raum und Performance mit feministischem Schwerpunkt. Sie hat die Erarbeitung der Performances im Rahmen der Ausstellung begleitet.
J: Inwieweit gibt es politische Kunst im starren Unibetrieb?
S: Inwieweit ist der Unibetrieb starr? Und was gilt als politische Kunst, und wer bestimmt das?
J: Ich bin zwar auch skeptisch gegenüber einer Konstruktion, die das Außerhalb derInstitution mit freier Beweglichkeit und das Innerhalb mit starrer Verunmöglichung gleichsetzt, da das selbst ein starrer und autoritärer Gegensatz ist. Gleichzeitig drückt sie aber doch eine von mehreren gültigen Realitäten aus. Was ermöglicht dir, sofort zu hinterfragen, ob die Uni überhaupt starr ist?
S: Ich habe sehr wenig mit Starrheit zu tun, für mich ist die Arbeit an der Uni locker und fein. Ich komm hin und lehre.
J: Aber die Arbeit, die du an der Uni machst, ist extrem unabgesichert und enorm gering bezahlt. Also hat deine Beweglichkeit schon ihren Preis.
S: Ja, aber ich möchte doch auch anmerken, dass gerade an der Linzer Kunstuni die Bemühungen zur Auflösung des starr-autoritären Meisterklassenprinzips zum Teil sehr weit reichend sind, und hier ganz anders nachgedacht wird als nur über Vorzeigeprofs.
J: Wie beschreibst du dein eigenes Unterrichten?
S: Ich mache Wissensvermittlung zu Performance und zur Geschichte von Performance, mit besonderem Schwerpunkt auf die Verknüpfung von Performance mit Feminismus. Interessant an Performance ist, neben der Tatsache, dass sie Konzepte ohne Objekte vermitteln kann, vor allem die Idee, dass man ganz anders an eine Betrachterin herantritt, also ein Publikum als Adressaten für einen Ablauf hat. Historisch entstand diese Idee des Rausgehens aus dem Atelier – und damit sich anders politisch einzumischen – in den politisierten Gesellschaften der 1970er Jahre. Eine der relevantesten künstlerischen Methoden für dieses Einmischen war das Format der Performance, besonders für die von den feministischen Bewegungen inspirierten Künstler_innen. Wichtig scheint mir allerdings, bei der Frage nach politischer Kunst aufmerksam zu sein in Bezug auf einen bestimmten Rezeptionsanspruch, der darauf beharrt, dass eine Arbeit klar verständlich sein muss, sonst ist diese Kunst nicht politisch. Dabei interessiert mich genau die Frage danach, wie politische, feministische Themen so aufscheinen können, dass eine Arbeit auch woanders hin führen kann, und sich nicht sofort eins zu eins das Politische daran ablesen lässt.
J: Neben der Herstellung von Adressierendem, über das du sprichst (und das in dem Titel unserer Ausstellung explizit wird) interessiert mich für mein Unterrichten, gemeinsam mit Leuten an der Produktion reflexiver Situationen zu arbeiten. Das heißt, darüber nachzudenken, was die Bedingungen einer Situation sind, welche dieser Bedingungen wie gestaltbar sind, und was die jeweiligen Wünsche aller Beteiligten an eine zu erzeugende Situation sind. Dies sind meiner Meinung nach die Grundvoraussetzungen, um überhaupt über die Produktion „politischer Kunst“ nachzudenken; wobei mir eher Begriffe nahe liegen, die eben mit der „Erzeugung reflexiver und herrschaftskritischer Situationen“ zu tun haben. Das finde ich zudem eine Voraussetzung für ein gemeinsames Arbeiten im Lehrbetrieb einer Universität, um vorgegebenen autoritären Strukturen nicht gänzlich aufzusitzen. Für mich bleibt zudem eine permanente Herausforderung, ob es so etwas wie eine „Anleitung zur Herrschaftskritik“ aus einer leitenden Position geben kann. In Bezug auf die Arbeit an der Ausstellung war für mich eine enorme Überraschung, wie groß das Interesse einer Arbeit mit Geschlechterkritiken von Seiten der Studierenden ist und wie entschieden der Wunsch, kontinuierlich an dieser Arbeit dran zu bleiben.
S: Ich finde allerdings, dass die Uni dringend einen richtig guten Ausstellungsraum braucht. Und wenn schon der Schirmmacher, dann müsste man diesen Raum von der Kunstuni aus richtig etablieren, mit einem „we are proud to present“: Teppich raus, Boden grau anmalen, eine Bar mit Betrieb und alle 2 Wochen abends ein DJ-Set. Das muss mindestens ausschauen wie eine New Yorker Galerie in den 80er Jahren, nicht wie ein verlassener Laden.
J: Und der Raum könnte eine grundsätzliche Ausrichtung bekommen, wie sie die KUPF hat – für Geschlechtergerechtigkeit, gegen Rassismus, mit spezieller Bevorzugung migrantischen und queeren Wissens, und er müsste von Lehrenden und Studierenden gemeinsam betrieben werden. Dann könnten wir weiterreden über politische, feministische Kunst im gar nicht starren Unibetrieb.)
Johanna Schaffer, mit Unterstützung von Stefanie Seibold
Johanna Schaffer forscht und lehrt zu antirassistischer, queer-feministischer Bildkritik und übersetzt im feministischen Übersetzungskollektiv „gender et alia“: http://www.genderetalia.sil.at