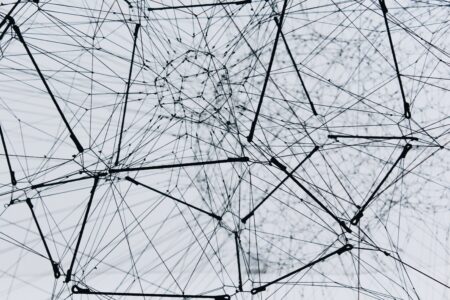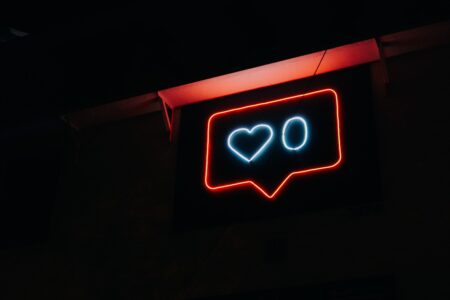Das heißt dann Gewöhnung an die Situation und wird Alltag genannt.Ein Stimmungsbild.
von Marlene Streeruwitz
Scheidungskinder haben es schwer. Vom Augenblick der Trennung der Eltern an ist das Getrennt Worden Sein stete Begleitung. In jedem Augenblick. Bis die Betäubung des Schmerzes eintritt, weil der Schmerz zu groß ist. Das heißt dann Gewöhnung an die Situation und wird Alltag genannt.
Der Wähler und die Wählerin in Österreich. Wir sind Scheidungskinder. Die Ehe der großen Koalition war nie sehr harmonisch gewesen. Es war immer nur eine Vernunftheirat gewesen. Aber der Schein war bewahrt worden. Auf einer pragmatischen Ebene war die Familie so intakt geblieben. Bürgerlicher Schein schafft ja auch Realität. Und die Kinder müssen sich nicht entscheiden, bei wem sie bleiben wollen und es steht nichts in den Dokumenten. Dafür müssen die Eltern die Form bewahren und dürfen nicht allzu hässlich übereinander reden. Oder streiten. In der Öffentlichkeit.
Die Koalitionsverhandlungen nach den letzten Wahlen waren eine Kette von misslungenen Versöhnungsterminen. Der Widerwille gegen den Partner war Schüssel ins Gesicht geschrieben. Und doch war es dann ein Schock, als es den „Neuen“ gab. Und noch dazu diesen. Bei der Pressekonferenz zu Blau/Schwarz traten Schüssel und Haider als das „neue Paar“ auf. Nervös und angespannt. Schüssel trotzig und mit der Hast agierend, die jede Rückkehr zum früheren Partner durch vollendete Tatsachen verhindern soll. Als wäre die Pressekonferenz eine von diesen Hollywoodfilmhochzeiten gewesen, bei denen der verlassene Partner auftaucht und gegen die neue Verbindung Einspruch erheben kann. Obwohl. Auch hier hätte der Einspruch nur aus den eigenen Reihen kommen können. Aber die Vorstellung, dass das Christliche sich vom Völkischen abgrenzen müsste. Diese Vorstellung überschätzt das Christliche und übersieht den Fundamentalismus darin. Die Geschichte hat diese Koalition ja schon gesehen. Sicherlich. Da war alles ganz anders. Aber das ist es ja immer. In der Geschichte. Nur. Unbändiger politischer Ehrgeiz und Ideologien, die bestimmte Menschenversionen vorschreiben und alle anderen denunzieren. Da ließen sich Parallelen ziehen.
„Ein minderheitenfeindliches Klima schadet nicht nur dem einzelnen Angehörigen der Minderheit, sondern genauso jedem einzelnen Angehörigen der Mehrheit:“ 1
Der Einspruch aus den Reihen der ÖVP blieb aus. Die Trennung von der SPÖ nach dieser langen Zeit. Wie der immer zu kurz gekommene Ehepartner wurde von der ÖVP das Recht auf eigene Entscheidung formuliert. Ein Recht auf Abenteuer. Midlife-Crisis und eine daraus abgeleitete Emanzipation. Trotzig. Wie gesagt. Nur Stimmung. Nur Emotion war das. Ein vorwurfsvolles Beharren auf der Entscheidung für sich. Und alles wie im Trivialroman, der Emanzipation mit dem Recht verwechselt, das Tapetenmuster allein aussuchen zu dürfen. Diesem Trotz kam ja dann das Ausland zu Hilfe. Die EU-Maßnahmen ermöglichten von Anfang an eine patriotische Aufladung des politischen Sprechens. Ermöglichte dieses „Wir“ herzustellen, das die Grundlage populistischen Ein- und Ausgrenzens ist. Mühelos wurden Wunsch und Wirklichkeit der blau/schwarzen Regierung so kongruent. Ohne Anstrengung war die Landschaft neu geschaffen.
„- es überfordert die Verarbeitungskapazität des Individuums, erzwingt daher grobe Simplifizierung der Wirklichkeit, Schwarz-Weiß-Malereien, Freund-Feind-Klischees;“1
Weil es bei Trennungen ja selten fair zugeht, war dem Verlasser hier auch noch die Wohnung geblieben. Trotzig ungeduldig hatte sich das „neue Paar“ festgekrallt. War einfach da geblieben und hatte das Türschloss ändern lassen. Der Einspruch von außen. Die EU-Maßnahmen. Die fehlende gesellschaftliche Anerkennung. In diesem Fall führte sie zu einer neuerlichen Trennung. Der skandalösere Partner musste weichen. Ohne diese Einmischung von außen wäre Schwarz/Blau schon früher vorbei gewesen. Aber. Das wissen wir erst jetzt. Können wir erst jetzt wissen. Und was hätten wir uns damit ersparen können. Aber wie die Kinder die Trennung und den Zerfall der gewohnten Umgebung jeden Augenblick neu lernen müssen und jeder Entwurf von Zukunft sich verbietet, hatte man oder frau dann auch alle Hände voll zu tun, die verschiedenen Loyalitäten zu begreifen. Wahrscheinlich war es ein paradiesischer Zustand. Das Paradiesischste was hierorts möglich war. Diese große Koalitionszeit. Und genau in diesem den Kindern vorgespielten Idyllischen war der Zustand lähmend. Stillstand. Eine sentimentale Konstruktion, in der Macht nur wirkt und nicht gesprochen wird. Nicht gesprochen werden muss. In der Selbstverständlichkeit gewohnter und ewiger Anordnung.
„- es verhindert die Ausdifferenzierung individualistischer Persönlichkeiten, weil es ständig zur Loyalität mit Gruppen zwingt;“1
Heißt die Tatsache, dass die Wähler und die Wählerinnen sich nun ganz einseitig für eine Seite entscheiden müssen. Dass man oder frau sich für einen der getrennten Partner entscheiden muss. Heißt das nun, dass eine neue Mündigkeit möglich wird. Sein muss. Hätte die Auflösung der paternalistischen Anordnung von Rot/Schwarz eine Politisierung zur Folge. Eine Politisierung, die über erste Aufgeregtheiten und Anpassungen und Widerstände hinausführen wird. Danach sieht es nicht aus. Ganz im Gegenteil.
Zwar ist es zu erwarten, dass eine Regierung sich in ihrem Regieren ausdrückt. Aber die Eile und Eilfertigkeit, mit der der politische Umbau betrieben wurde. Die Unverfrorenheit der Postenbesetzungen. Der Ton Nichtregierungsanhängern gegenüber. Das erinnert an die Schwierigkeiten, die schon die Großväter miteinander hatten. Und das erinnert an die Beseitigung jeder Erinnerung an den Partner. Das beschreibt einen ungeheuren Drang, alle und alles für sich zu reklamieren. Allen und allem den Stempel aufzudrücken. Sich zu unterstellen. Die Idee, die Aufnahmsprüfung für die Mittelschule wieder einzuführen, ist für mich das deutlichste Beispiel dieses nostalgischen Rückbaus in eine alte Ordnung. Der vordergründig harte Ton einer Elisabeth Gehrer. Oder der belehrenden Blockierung von Argumenten eines Wolfgang Schüssels. Es ist immer diese Sehnsucht nach Harmonie und Ordnung. „So ist es.“ „So soll es sein.“ Und alle sollten sich damit abfinden und glücklich sein. Kein Argument wird aufgenommen und weiter besprochen. Weiter entwickelt. Solche Diskursunfähigkeit und Diskursverweigerung gründen sich auf der schwarz/weiß-Maltechnik der Gesinnungsgemeinschaft, die durch das „neue Paar“ zur Tätergemeinschaft aufsteigen konnte. Die nun Ordnung machten. Ohne zu fragen. Und diese Ordnung. Die ist nur für sich selber da. Die hilft nur denen, die sie durchsetzen. Diese Ordnung ist ein Lebensberechtigungsnachweis für Blau/Schwarz. Sonst nichts. Selten war es so klar, wie sehr das Regieren die Regierenden ermöglicht.
„- es schränkt die sprachliche Kompetenz der Individuen ein, weil es Einsprachigkeit belohnt, Zweisprachigkeit jedoch bestraft; das Resultat ist Sprachlosigkeit;“1
Während des Hochwassers. Entsetzen und Verzweiflung in den Gesichtern der Betroffenen. Jammer. Wut. Trauer. Kein einziges Mal war einer oder eine in der Lage zu sagen, dass das alles schrecklich sei. Entsetzlich. Grauenhaft. Aber dass man oder frau ja nun in Österreich lebte. In einem reichen Land, in dem Solidarität eine Selbstverständlichkeit ist. Ein Land, in dem man oder frau sich sicher fühlen könnte. Jedenfalls nicht verlassen. Schicksalsschläge. Und deren Folgen. Die Gesellschaft gleicht das aus. Jedenfalls die äußeren Umstände. Es bleibt ja noch genug Leid. Und das ist traurig genug. Keiner und keine in Interviews in den Medien oder im persönlichen Gespräch, die sich darin sicher gefühlt hätte. Oder auch nur auf die Idee gekommen wäre, dass es durchaus eine Selbstverständlichkeit sein sollte, in solchen Krisen auf den Staat zurückgreifen zu können. Dass das ein Recht sein könnte. Vor aller Spendenfreudigkeit. Dafür gäbe es den Begriff Staat, der schon ein bisschen mehr sein sollte, als die Summer der Staatsangehörigen an Spendentelefonen.
Die Sprache zur Hochwasserkatastrophe. Die hat es noch deutlicher an den Tag gebracht. Die Politiker und Politikerinnen von Schwarz/Blau sahen sich als Verteiler der Unterstützung. Von oben herab wurde die Selbstverständlichkeit der Hilfe beschworen. Selbstverständlichkeit liegt aber nur vor, wenn es nichts zu beschwören gibt. Die Beteuerungen der Regierung ließen auf das Gegenteil schließen. Viktorianische Beglückungshaltung ist das. Ich kenne das sonst aus der Welt der Kultursubventionen, wenn zum Beispiel die Präsidentin der Salzburger Festspiele sagt, sie habe diese Veranstaltung doch bezahlt und daraus ableitet, nicht kritisiert werden zu dürfen.
„- es produziert depressive Menschen, insbesondere unter der Gruppe der Assimilanten, weil das kollektive Sterben der „verratenen“ Herkunftsgruppe vom Individuum unbewusst schuldhaft erlebt wird.“1
Die Sprache des Wahlkampfs bedient sich der Gegnermuster aus den 50er Jahren. Sanft. Weil stärkere Worte unsympathisch machen, und den Wähler und die Wählerin gegen den Verwender der starken Worte einnehmen könnten. Aber in den Fernsehdiskussionen ist es zu hören. Frontstellung. Und wie immer die Schwierigkeit eines differenzierten Ausdrucks. Die Spracherfahrungen der Hochwasserkatastrophe sollten ausreichen, jedem und jeder klarzumachen, dass im populistischen Sprechen. Und besonders im neoliberal verbrämten populistischen Sprechen. Dass da jeder und jede sofort in die Schwarzkategorie dieses Sprechens fallen kann. Die Hochwasseropfer wissen es schon. Am berühmten Stammtisch wird das schon formuliert. Die hätten sich bereichert, heißt es da. Die hätten die Formulare ja so ausgefüllt, dass sie sich jetzt sanieren können. Der gute alte Freund Neid wird auf den Plan gerufen, die Hochwasseropferhilfeempfänger zu denunzieren. Damit sind sie Hilfeempfänger. Sie erschleichen sich unberechtigt hohe Mittel. Sie sind also Sozialschmarotzer. Und das alles, weil eine Gesellschaft die Ansprüche an sie nicht in selbstverständlichem Selbstbewusstsein formulieren kann. Und will.
Die Arbeitslosen kennen diesen Mechanismus der sprachlichen Denunzierung und der nachfolgenden Eliminierung aus der Kommunikation aufgrund der Kriterien dieser Denunziation. Es müssen also so viele Gruppen und Individuen wie möglich in die politische Kommunikation hineinreklamiert werden. Das ist die Aufgabe der nächsten Wahl. Es geht darum, so viele Sprachen wie möglich in der Politik zu erhalten, um dann zu einer anderen Formulierung der Beziehung des Staates zu den ihn Bildenden zu kommen. Die seltsame Lethargie dieser Wahl gegenüber hat mit der Scheidungskindersituation zu tun. Die vielen Unentschlossenen wissen nicht, bei wem zu „wohnen“ sich lohnt. Haben wohl auch das Interesse an einer solchen Entscheidung verloren. Viele Scheidungskinder wollen es selber besser machen. Als die Eltern. Den Eltern beweisen, dass sie es schaffen. Auf die Politik umgelegt, ist damit Haider erklärbar. Oder Schüssel. Demokratie ist nur in Vielstimmigkeit und Akzeptanz von Konflikt und Veränderung möglich. Ordnung ist das Gegenteil davon. Wer immer Ordnung verspricht, der oder die hat schon zu genaue Vorstellungen, wie es sein soll. In solche Vorstellungen hineinzupassen. Das ist die traurige Anpassungsarbeit autoritär erzogener Kinder, die sich die Liebe ihrer Eltern verdienen wollen. Und müssen. Vielleicht können die Wähler und Wählerinnen ihr Verhalten nach rationaleren Gesichtspunkten ausrichten, als nach der emotionalen Frage, wo man oder frau dazugehören will. Oder soll. Und vielleicht werden sie dann ernster genommen. Vor allem, wenn der Staat gebraucht wird.
Marlene Streeruwitz
1 Keupp, Heiner: Riskante Chancen. Das Subjekt zwischen Psychokultur und Selbstorganisation. Heidelberg 1988. S 31.