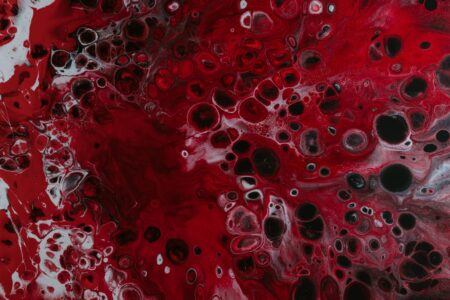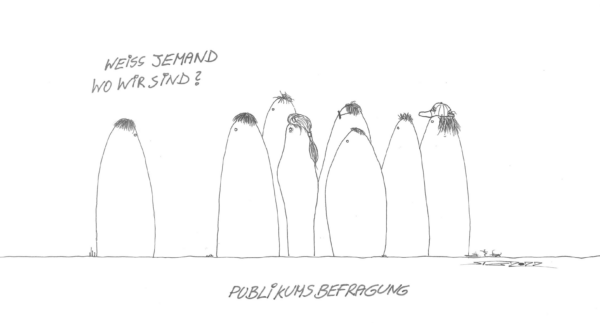Über Arbeitswelten, die bei Crossing Europe nicht nur filmisch behandelt wurden, weiß Franz Fend zu berichten.
Markus Binder sagte es bei der Eröffnung des Filmfestivals Crossing Europe bei der Eröffnungsgala in kurzen Worten, aber nichtsdestotrotz eindringlich: Wer über Geld verfüge, sollte dies dem Filmemacher Markus Kaiser-Mühlecker zukommen lassen. Anlass für diese Aufforderung war, dass die Postproduktion des Filmes „Attwenger Adventure“ noch nicht finanziert war.
Schon bei der Festivaleröffnung wurde manifest, was während der gesamten Dauer der Veranstaltung stets Thema war. Das Filmemachen hierzulande ist, vor allem wenn man sich nicht im Sog des cineastischen Mainstreams befindet, kein leicht verdientes Brot. „Ja, Ideen für neue Filmprojekte hätte ich einige“, sagt der deutsche Regisseur Jan Peters, „aber keines der Projekte ist bis dato ausreichend finanziert“. Oder: „Ja, ich habe ein weiteres Projekt eingereicht, aber vorher muss ich mir einen Job suchen, weil die Finanzierung meines Films in der Luft hängt“, so eine Linzer Filmemacherin.
Beim Festival Crossing Europe wurde nicht nur die künstlerische Dimension des europäischen Autorenfilms verhandelt, sondern auch die Bedingungen, unter denen das Filmemachen stattfindet. Und diese Bedingungen sind keinesfalls rosig. Nicht in den östlichen und südöstlichen Nachbarländern, wo es kaum eine staatliche Filmförderung gibt. Auch hierzulande werden die meisten Arbeiten abseits der (verhältnismäßig) großen Töpfe, wie dem Film-Fernsehabkommen realisiert. Crossing Europe, bot somit nicht nur einen signifikanten Querschnitt der europäischen Off-Film-Produktion, sondern auch eine Werkschau prekären Arbeitens. Ein Blick in den Festivalkatalog bestätigt: Vor allem bei den Produktionen in der Kategorie Local Artists sind Produktion, Vertrieb und Verwertung bei den AutorInnen selbst angesiedelt. In den seltensten Fällen finden diese Produktionen einen professionellen Vertrieb. Die Förderungen, so sie überhaupt vorhanden, reichen gerade einmal für die Fertigstellung des Films.
Planungssicherheit ist für die KünstlerInnen ein Fremdwort. Und dass auch das Festival, das diesen Low-Budget- oder gar No-Budget-Produktionen eine Plattform bietet, selber notorisch unterdotiert ist, war ebenfalls nicht zu überhören. Die Arbeitswelt wurde nicht nur als Meta- Thema des gesamten Festivals verhandelt, eine eigene Programmschiene Arbeitswelten stand dieses Jahr unter dem Motto „Umbrüche und Aufbrüche“. Programmiert wurde dieser Festivalteil vom Kinoreal-Team in Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer. Ein bemerkenswertes Unterfangen des Festivals, spielen doch die Arbeitswelten im Fernsehen oder im Kino hierzulande kaum eine Rolle. Obwohl das Arbeitswelt-Programm des letzten Jahres konzentriert den Blick der Unternehmen, der Manager und der Konzerne zeigte, konnte dieser Blickwinkel auch heuer nicht ganz ausgeschaltet werden. Mobilität und Flexibilität, so die Kuratoren, seien die wichtigsten Anforderungen an die ArbeitnehmerInnen in einer globalisierten Welt.
Bezeichnend, wie der Blick der ArbeitnehmerInnen gegen jenen der Unternehmer ausgewechselt wird, war Sandra Jakisch‘ Film „Stuttgart – Shanghai“. In ihm ging es nicht darum, dass Arbeitnehmer nach China emigrieren, sondern dass ein Unternehmersohn samt Ehefrau dem Vater nach China folgt, um dessen Firma zu übernehmen. Dies wurde als kolonialistische Erzählung vermittelt, die staunen machte. Über die chinesischen ArbeitnehmerInnen wurde nur herablassend in Singularismen gesprochen: „Dem Chinesen macht es nichts aus, wenn es stinkt“. Die Verhältnisse wurden in ihr Gegenteil verkehrt: Jene, die nach China gekommen sind, um die dortigen Arbeitskräfte auszubeuten, wurden als Opfer dargestellt. Im Mittelpunkt der Erzählung stand schließlich die Unternehmergattin, die kein geeignetes Krankenhaus für ihre Entbildung finden konnte. Als ob Kinderkriegen in China nicht die gleiche Wichtigkeit wie das Umfallen eines Fahrrades in China hätte. Die Botschaft dieses Films, in China kann man super zu Reichtum kommen, wenn man nicht zimperlich ist. Was kümmert einen da schon „der Chinese“.
Dass es auch anders geht, zeigt Jan Peters Film „Wie ich ein freier Reisebegleiter wurde“, der in 15 Minuten vorführt, was sich die Arbeitsministerien unter Flexibilität und Innovationswillen bei Arbeitnehmern vorstellen. Mit Witz zeigt Peters unterschiedliche Ich- Ags beim Flaschensammeln, Gastronomielehrlinge, die sich ihre Ausbildung nur mit Zweitjob finanzieren und eben einen freien Reisebegleiter, der mit einer Gruppenkarte der Öffis in Frankfurt Ankommenden am Flughafen ihre Dienste anbieten. Arbeitswelt, die trotz des nötigen Sarkasmus im Film für immer mehr Menschen einsame und gar nicht lustige Realität geworden ist. Dass in der Reihe Local Artists einige Filme zu sehen waren, die ausgezeichnet in das Arbeitswelt Programm gepasst hätten, und womöglich das Thema besser getroffen hätten, ist vielleicht nur eine Ironie der vorliegenden Produktionsverhältnisse.
Franz Fend lebt und arbeitet in Linz.